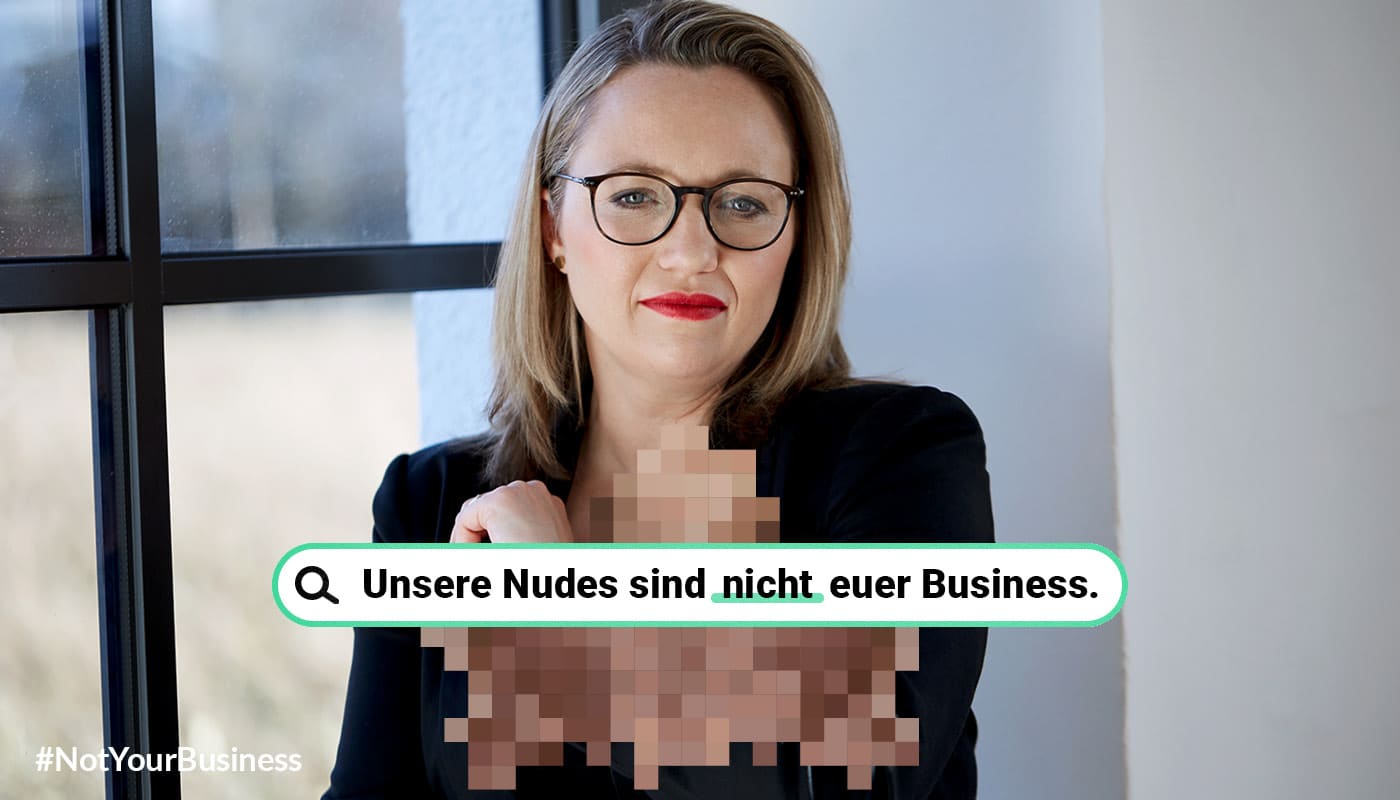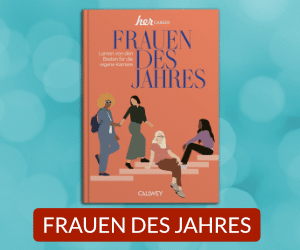Als Geschäftsführerin der Tafel Deutschland erzählt Sirkka Jendis, wie Armut im Alltag ausgrenzt, einschränkt und stigmatisiert. Sie leitet konkrete Forderungen an die Politik ab, mit denen die systemischen Ursachen von struktureller Armut bekämpft werden können.
Und sie spricht uns alle an: Es braucht Menschen, die hinschauen, sich verbünden und gemeinsam dafür sorgen, dass niemand ausgeschlossen und benachteiligt wird. Ihr Buch ist ein eindrückliches Plädoyer: für ein neues Menschenbild, eine wirksame Armutsbekämpfung und eine mutige Zivilgesellschaft.
Thema
Gesellschaft, Geld, Finanzen & Vorsorge
Angaben zur Referentin
Sirkka Jendis ist Geschäftsführerin der Tafel Deutschland, dem Dachverband von über 970 Tafeln in Deutschland. Zuvor war die studierte Kommunikationswissenschaftlerin Vorständin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Dozentin und in leitender Funktion in der ZEIT-Verlagsgruppe tätig. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin.
Angaben zur Moderatorin
Kristina Appel ist Journalistin im Bereich Chancengerechtigkeit und Frauen*. Sie übt sich in intersektionalem Feminismus, ärgert sich über patriarchale Strukturen und beobachtet die Entwicklungen zur Arbeit der Zukunft. Mit Geduld und Nachdruck hinterfragt sie veraltete Strukturen und sucht – so auch bei der herCAREER Academy oder für den Podcast herCAREER Voice – mit ihren Gesprächspartner*innen nach Lösungen für mehr Gleichberechtigung.
Der Beitrag wurde im Rahmen der herCAREER Expo 2024 aufgezeichnet und als Podcast aufbereitet.
[00:00:00] Sirkka Jendis: Wir sehen an allen Studien die Spaltung, die Zukunftsaussichten werden sehr pessimistisch gerade bewertet von allen, und ich denke, wir müssen zumindest versuchen, diesen Zusammenhalt zu stärken, denn ich bin der festen Überzeugung, dass auch wohlhabende Menschen mehr davon haben, wenn es weniger arme Menschen gibt im Land.
[00:00:37] Kristina Appel: Willkommen beim HerCareer Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen? Dann bist du hier genau richtig. Armut hat System. Das sagt Sirkka Jendis, Geschäftsführerin der Tafel Deutschland. Und Armut ist weiblich. Sie wird vererbt und macht krank. Derzeit sei der beste Schutz vor Armut, in eine wohlhabende Familie geboren zu werden. In unserem Live-Gespräch auf der HerCareer Expo habe ich Sirkka Jendis gefragt, was passieren muss, damit sich das ändert.
[00:01:40] Kristina Appel: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kristina Appel. Ich bin Journalistin und ich habe das große Glück als Redakteurin bei HerCareer zu arbeiten. Wir sind jetzt hier, um über das Buch zu sprechen. „Armut hat System“. Herzlich willkommen, Sirkka Jendis.
[00:01:55] Sirkka Jendis: Vielen Dank.
[00:02:01] Kristina Appel: Du bist Geschäftsführerin der Tafel Deutschland, du forderst eine Zeitenwende für unser Land in deinem Buch. Du hast sehr anschaulich beschrieben, was du im Alltag und in deiner Funktion jetzt bei den Tafeln beobachtest, was du über Armut gelernt hast und welche Schlüsse du daraus gezogen hast, nämlich, wie es der Titel auch sagt, unser System versagt. Ich falle mal mit der Tür ins Haus und zwar: 60.000 Helferinnen und Helfer, die bei über 975 Tafeln mit über 2000 Ausgabestellen arbeiten. Das klingt nach wirklich sehr viel Bedarf.
[00:02:43] Sirkka Jendis: Erst mal schön, dass ich hier dabei darf. Ja, tatsächlich können wir sagen, dass wir bei den Tafeln in den letzten Jahren eigentlich von einer Krise in die nächste geschlittert sind. 2015 mit der ersten, mit den vielen Geflüchteten, dann Corona und jetzt seit über zwei Jahren durch den Ukraine-Krieg haben wir einen großen Zulauf, aber auch durch die Inflation und Preissteigerungen auch kommen wirklich auch viele, die, glaube ich, uns selbst dann auch sagen, sie hätten nie gedacht, dass sie mal so viel Unterstützung brauchen. Allerdings klingt es natürlich auch nach vielen Menschen, die helfen wollen, nach vielen, die Unterstützung geben und das ist ja wiederum auch einfach toll. Aber es ist tatsächlich so, dass sich immer noch neue Tafeln gründen, vereinzelt, weil es ja schon sehr, sehr viele gibt, aber der Bedarf ist weiterhin sehr hoch. Und viele Tafeln haben Aufnahmestops oder Wartelisten. Das heißt, hätten eigentlich deutlich mehr, die zu ihnen kommen würden.
[00:03:38] Kristina Appel: Wer gilt denn in Deutschland als arm?
[00:03:40] Sirkka Jendis: Es wird unterschieden zwischen absoluter und relativer Armut. Absolute Armut meint dann wirklich international, wenn man quasi an Hungern leidet. In Deutschland und auch in Europa wird das umfassender definiert, weil man eben sagt, zu Armut gehört natürlich mehr. Und es kommt auch darauf an, in welcher Region man lebt, in welchem Land man lebt, was als arm gilt. Und da sagt man immer, wer weniger als 60 Prozent des Netto-Äquivalenzeinkommens, also des Medians besitzt, das sind in Deutschland für eine Person zurzeit so 1300 Euro, der gilt als arm und armutsgefährdet.
[00:04:18] Kristina Appel: Du betontst ganz am Anfang schon in deinem Buch, dass ihr eine NGO seid, ein gemeinnütziger Verein, eine Einrichtung und dass du erlebst, dass der Staat sich sehr stark auf eurer Leistung und eurem Engagement sehr stark darauf baut. Kann oder will der Staat da nicht mehr aktiv werden?
[00:04:37] Sirkka Jendis: Wir sind ja kein Unternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist, sondern wir sind ja ein Unternehmen, wo wir eigentlich wollen – oder ein Verband – dass nicht so viele unsere Leistung in Anspruch nehmen müssen. Und tatsächlich haben wir vor allen Dingen während des Ukraine-Krieges, als ja wirklich sehr schnell sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, gemerkt und von vielen Tafeln gehört, dass der Staat eben gesagt hat, wir haben erst in vier, fünf, sechs Wochen einen Termin, geht doch so lange zu den Tafeln. Die Problematik ist also sozusagen sehr vielschichtig, aber vor allen Dingen konnten dann natürlich die Geflüchteten auch nicht wissen, wir können ja nur das verteilen, was wir sammeln. Also die Tafel-Idee ist ja, wie ich finde, so einfach wie genial. Es werden überschüssige Lebensmittel eingesammelt. Das heißt, wir haben ja auch eine ökologische Idee, und die eben an armutsbetroffene Menschen verteilt. Das heißt alles, was eingesammt wird, wird verteilt, aber wir sind ja kein… also wir haben nicht alle Produkte. Wenn solche Aussagen getroffen werden von staatlicher Seite, dann denken die Menschen natürlich, hier bekommen sie jetzt erst mal ihre Erstausstattung. Und zum anderen geht das natürlich nicht. Also für die Armutsbekämpfung ist der Staat zuständig. Wir sind eine Freiwilligenorganisation. Die Idee ist auch, also die Tafelbewegung hat sich unter anderem auch gegründet, um das Leben so ein bisschen leichter zu machen. Also um den Kinobesuch zu ermöglichen für das Kind vielleicht, weil man ein bisschen Unterstützung gibt. Und wir merken eben, dass wir wirklich existenziell gebraucht werden. Und das war nicht die Grundidee.
[00:06:09] Kristina Appel: Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast im Buch Hauptgruppen identifiziert, die bei uns besonders armutsgefährdet oder armutsbetroffen sind. Welche Gruppen sind das?
[00:06:20] Sirkka Jendis: Ich beschreibe die ja auch jeweils in einem Kapitel, das sind natürlich erstmal Menschen mit gar keiner Ausbildung und dementsprechend schlecht ausgebildet, die keine Arbeit haben. Also das wichtigste Mittel gegen Armut ist immer noch Arbeit natürlich, um die Menschen in Arbeit zu bekommen. Dann sind es aber auch zunehmend Rentnerinnen und wenn wir uns den demografischen Wandel angucken, dann rollt da ja auch noch etwas auf uns zu und auch auf die Tafeln zu. Es sind Alleinerziehende und Familien mit mehr als drei Kindern oder mindestens drei Kindern hauptsächlich und die vierte gefährdete Gruppe ist Menschen mit Migrationsgeschichte. Durchgängig durch alle Gruppen kann man sagen: Armut ist weiblich. Das heißt, in allen Gruppen sind Frauen leider überrepräsentiert.
[00:07:07] Kristina Appel: Und deswegen wollte ich mich heute auch im Speziellen vor allem auf die Frauen konzentrieren, weil wir damit alles so ein bisschen abdecken, leider. Die UN schreibt, jede fünfte Frau ab 95 Jahren gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Da gibt es Gründe wie eine Hinterbliebenenrente, die vielleicht nicht da ist oder so. Aber hilf uns noch besser zu verstehen: Warum wird es so schnell prekär für Frauen?
[00:07:31] Sirkka Jendis: Das Problem haben natürlich auch ganz viele andere Länder, dass Frauen armutsgefährdeter sind als Männer. Wir haben in Deutschland ein spezifisches Problem, ich sag gerne, wir haben eine relativ gut ausgebildete Gruppe in Deutschland, die relativ wenig arbeitet und das sind Frauen. Das sehen wir jetzt gerade bei Rentnerinnen, da haben wir einen ganz großen Anteil an weiblichen Rentnerinnen, weil sie einfach unterbrochene Erwerbsbiografien haben, weil sie lange Care-Arbeit geleistet haben, weil sie vielleicht lange gar nicht gearbeitet haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Grund, dass man eben armutsgefährdet ist oder arm. Und wir haben ja auch aktuell eine relativ hohe Teilzeitquote. Und wenn ich beispielsweise in einem Beruf arbeite, in dem man sowieso nicht so viel verdient, sagen wir mal in der Pflege, und vielleicht auch noch nicht mal in Teilzeit arbeite, weil ich Kinder zu erziehen habe, sondern vielleicht auch einfach, weil der Job so anstrengend ist, dass ich in Teilzeit arbeite, dann komme ich natürlich ganz schnell auf sehr, sehr wenig Gehalt. Wenn dann die Preissteigerungen nicht aufgefangen werden, wenn die Löhne nicht armutsfest sind, dann habe ich eine viel höhere Gefährdung. Oder dann natürlich durch Scheidungen. Wir wissen alle, dass in der Regel dann die Kinder, dass mehr Care-Arbeit bei den Frauen immer noch ist. Das sind alles Punkte, die Frauen wirklich armutsgefährdeter machen.
[00:08:49] Kristina Appel: Was du beschreibst, ist, dass die Strukturen nicht so funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel Sorgearbeit besser bezahlen würden oder Sorgearbeit mehr Rentenpunkte einbringen würde, könnten wir das für Frauen erleichtern, wenn Teilzeit auch für Männer normaler werden könnte, wenn sich einstellen würde, dass weniger Arbeit nicht weniger soziale Leistung bedeutet und wir unsere Sozialleistungen verändern könnten, könnte das funktionieren. Was du jetzt beschrieben hast, ist ganz klar das, was auf deinem Buchtitel steht, nämlich Armut hat System, Armut ist strukturell bedingt. Von welchen Narrativen über Armut müssen wir uns also lösen?
[00:09:28] Sirkka Jendis: Ich versuche so ein bisschen in diesem Buch auch darauf einzugehen, also Armut und auch natürlich die Lösung hat viel mit Geld zu tun. Das ist klar, wir brauchen für alles Geld und trotzdem versuche ich auch so ein bisschen einzuladen dazu, auch wirklich so einen Perspektivwechsel mal vorzunehmen. Einfach zu hinterfragen, wie ist eigentlich unser eigenes Bild von Armut? Was glauben wir eigentlich, welche Menschen arm sind? Was haben wir für ein Bild davon? Und was haben wir auch so ein Bild von Leistung. Leistung ist bei uns ganz häufig der Lohnzettel und eben nicht, was wir sonst so alles leisten an ehrenamtlicher Arbeit, an Care-Arbeit. Und was uns bei den Tafeln, aber auch mir persönlich wirklich Sorgen macht, ist, dass wir medial eine sehr, sehr, ja, wir merken, es wird zunehmend rauer und wir merken, dass sehr stark mit wirklich Narrativen gearbeitet wird, die eine Minderheit von Menschen – also wir müssen ja erstmal von den Zahlen ausgehen, die wir haben. Und wenn wir andere Zahlen haben, dann können wir auch über andere Zahlen reden. Aber wir wissen, dass wir ungefähr… wir haben 5,4 Millionen Bürgergeldempfänger:innen in Deutschland und nach dem, was die Bundesagentur für Arbeit sagt, haben wir vielleicht so 15.000, die mit dem sogenannten auch umstrittenen Begriff der „Totalverweigerer“ bezeichnet werden. 15.000. Das sind 0,04 Prozent der Bevölkerung. Ich wage die These, die können wir uns leisten. Ja, ich finde das auch nicht gut. Ich finde auch Menschen, die das Sozialsystem ausnutzen, das geht nicht. Aber ich finde, es ist eine absolute Minderheit, sie wird oft als Mehrheit dargestellt. Und wir haben gleichzeitig 800.000 Menschen, die arbeiten und trotzdem aufstocken müssen. Da müssen wir uns doch vielleicht eher mal um die kümmern, weil das kann ja wohl nicht sein, dass Leute was machen und dann trotzdem nicht genug Geld damit verdienen. Also insofern halten sich wirklich auch Fake News zum Beispiel, Arbeit lohnt sich nicht, man hätte mehr mit Bürgergeld, es ist in jeder Konstellation falsch. Wir können gerne über das Lohnabstandsgebot reden, ob das hoch genug ist, ich würde dann sagen, ja dann höheren Lohn und nicht bei Bürgergeld kürzen, andere sehen das anders, aber ja, ich versuche dagegen anzugehen und zu sagen, wir brauchen diese Spaltung nicht. Wir brauchen die Empathie für diese Menschen und nicht diese Spaltung, die da irgendwie doch sehr stark medial auch gerne nach vorne getragen wird von auch vielen Politikern.
[00:11:49] Kristina Appel: Wir sprechen ja heute auf einer Karrieremesse, darum möchte ich auch ein bisschen über Arbeit sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, das beste Mittel gegen Armut ist Arbeit. Du hast im Vorgespräch auch unseren Bundesarbeitsminister zitiert. Du hast ihm aber noch was zuzufügen. Also es reicht nicht Menschen in Arbeit zu bringen, sondern wir müssen auch…
[00:12:10] Sirkka Jendis: Naja, die Arbeit muss armutsfest sein. Wir müssen Löhne haben, die armutsfest sind und die dann auch in der Rente armutsfest sind. Wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Insofern müssen wir den Anspruch haben, dass bei uns Rentnerinnen, wenn sie dann sozusagen in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen oder natürlich auch Menschen, die jetzt arbeiten, kaum über die Runden kommen oder wirklich eben zu den Tafeln kommen müssen. Und eigentlich denke ich, also es ist in jeder Hinsicht sinnvoller, ökonomisch die Menschen in Arbeit zu bekommen, weil sie dann natürlich keine Leistung beziehen müssen, weil sie dann sozusagen für sich selbst sorgen können. Deshalb denke ich eigentlich immer, der Finanzminister müsste der größte Verfechter sein, diese Dinge zu ändern. Das scheint mir nicht so zu sein, aber eigentlich ist es das Wichtigste, die Menschen in Arbeit zu bekommen. Und das möchte durchaus der Bundesarbeitsminister, ich weiß nicht, ob er alle, ob es nicht noch mehr, durchaus mehr Mittel geben müsste, weil wir natürlich da jetzt ganz schnell dann auch an den Punkt kommen, wir fangen ja ganz früh an, Kinder zu verlieren, weil wir ein sehr, sehr ungerechtes Bildungssystem haben, weil die Chancengerechtigkeit sehr ungleich verteilt ist. Und da müssen wir ansetzen, weil das ist dann… Wir haben einfach sehr viel vererbte Armut und da müssen wir eigentlich ansetzen, um zu sagen, die brauchen wir ja auch alle, Stichwort Fachkräftemangel. Da tut die Gesellschaft vielleicht, auch die, finde ich, muss was tun, aber auch die Politik zu wenig.
[00:13:44] Kristina Appel: Ich frage mich dann, was können wir, und das ist ganz häufig heute meine Frage gewesen, wenn das Problem im System liegt, wie können wir als Individuen dazu beitragen, dagegen anzugehen, auch auf individueller Ebene zu helfen. Und weil wir heute hier sind und viele Recruiterinnen da sind, einstellende Fachkräfte, Chef:innen, was können wir tun, wie können wir dafür sorgen, dass mehr Menschen und gerade auch gefährdete Menschen in Arbeit kommen?
[00:14:10] Sirkka Jendis: Also der oder die Einzelne kann, glaube ich, viel tun, auch in seinem oder ihrem Umfeld, indem man einfach vielleicht für sich mal hinterfragt seine Bubble, in der man vielleicht häufig ist, auch verlässt, Begegnungen zulässt. Vielleicht hinterfragen, ob ein Kind nicht zu einem Geburtstag kommt, weil es sich einfach kein Geschenk leisten kann und deshalb nicht kommt. Dass man doch mal bei der Nachbarin nachfragt… Wenn man das Gefühl hat, da können vielleicht Hilfe benötigt sein. Also dieses empathische aufeinander Zugehen und Menschen, denen es vielleicht schlechter geht und eben auch ökonomisch schlechter geht, zu helfen, das können wir glaube ich alle tun. Unternehmen und auch Verbände, Vereine können glaube ich einfach sich diese Perspektivwechsel, dieses: Ich traue dem Einzelnen, der vielleicht doch einen sehr großen Zickzack-Kurs hat, jetzt doch einiges zu. Ich mache vielleicht auch Corporate-Volunteering-Programme, dass man sich das mal angucken kann, wie wird bei uns gearbeitet oder wird bei den anderen gearbeitet, also auch da so, diesen Blick darauf. Also ich bin auch, ich war noch nie armutsbetroffen, ich maße mir nicht an, zu wissen, wie das Leben wirklich ist. Ich habe nur die Haltung, das verstehen zu wollen und diese Empathie zu versuchen zu empfinden und auch ich habe noch viel gelernt und ich bin viel bewusster, dass diese ganzen kleinen zusätzlichen Ausgaben, die wir alle so nebenbei tätigen können und vielleicht bezahlen können, was das bedeutet für Menschen, die das eben nicht haben und für diese ganzen kleine Ausgabe für Schule und Kita und sonst was kann man auch nicht jedes Mal einen Antrag stellen. Es gibt ja schon Unterstützungsmöglichkeiten, aber es ist so viel mehr und also und Unternehmen können einfach dann auch sagen, die oder der Person gebe ich mal eine Chance und ich traue mir diesen Perspektivwechsel auch. Wichtig ist mir eben immer zu sagen, Armut ist einfach so, so viel mehr als dieser Mangel an Geld. Armut ist einfach dieser Mangle an sozialer Teilhabe. Ich kann am Sportverein nicht teilnehmen. Ältere Menschen werden einsam. Das ist ein großes Schamthema. Warum eigentlich? Das hat natürlich mit diesen Narrativen zu tun. Warum ist das eigentlich so? Weil man eben doch denkt, ich bin ja selber schuld.
[00:16:16] Kristina Appel: Ich bin ja selber schuld, ja. Jetzt reden wir auch gerne von der Meritokratie. Wir sagen, wir sind eine Leistungsgesellschaft und wer viel gibt, der kriegt auch viel zurück. Ich glaube, sehr viele von Frauen und weiblich gelesenen Personen wissen, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Und wenn wir dann über diese Grenze hinausgehen und mehrfach die diskriminierten Menschen angucken, wissen wir, es ist einfach nicht die Wahrheit. Es ist eine ganz dicke, fette Lüge, die sich sehr hartnäckig hält. Und jetzt habe ich letztens gerade einen Bericht vom World Economic Forum gelesen und da ging es um die Durchlässigkeit in Deutschland. Und auch du hast mir erzählt, sozialer Aufstieg ist bei uns recht schwer. Jetzt weiß ich, dass wir im internationalen Vergleich auf Platz 11 von 82 Nationen liegen. Das ist natürlich nicht furchtbar schlecht, aber für ein westliches Land wie unseres und das reichste Land in Europa ist es nicht ganz so gut. Wie erlebst du das bei den Tafeln? Wie lange kommen diese Menschen auch zu euch?
[00:17:19] Sirkka Jendis: Tatsächlich kann ich das aus der Arbeit nur bestätigen. Wir haben viele, viele Menschen, die schon sehr, sehr lange zu den Tafeln kommen. Und wo es wirklich einfach schwer ist, da raus zu finden und eben Kinder dann auch schon zu den Tafeln kommen, also Familien natürlich. Die Tafeln machen ja inzwischen sehr, sehr viel mehr als nur die Lebensmittelausgabe. Es gibt ganz, ganz viele Projekte zu Beginn von Schule oder Nachhilfeunterricht oder Kleiderkammer oder Mittagstisch oder Seniorencafé oder Friseure und so weiter. Wir sehen ja auch, was oben steht, oben stehen die skandinavischen Länder und wir wissen in jeder Studie sozusagen, dass die Chancen sehr stark vom Elternhaus abhängen. Das heißt also die beste Versicherung in Deutschland gegen Armut ist immer noch, in ein vermögendes Elternhaus hineingeboren zu werden. Das ist am allerbesten. Dann hat man es gut. In der Regel jedenfalls. Und die Chancen, die damit eben verbunden sind. Und wir dürfen einfach nicht außer acht lassen, dass dann eben da viel dranhängt, also wenn ich nicht das… Ich werde oft gefragt, warum denn es nicht mehr, sozusagen, ich sage oft, arme Menschen haben keine Traktoren, also die haben keine Lobby, man kann nicht. Sich politisch zu engagieren und auch teilzuhaben kostet eben auch Geld und kostet auch Kraft, die dann armutsbetroffene Menschen oft nicht haben. Und wir sehen genau, in jeder Studie, dass das Elternhaus in Deutschland sehr, sehr entscheidend ist für den Bildungsaufstieg. Und wenn ich mir so persönlich das Schulsystem angucke aus eigener Erfahrung, kann ich bestätigen, dass natürlich dieses: Ich löse es dann mit Geld oder im besten Falle versteht das Elternhaus überhaupt, was gemacht werden soll in der Schule und so weiter und so fort. Oder ich habe überhaupt ein eigenes Zimmer oder einen kleinen Rückzugsraum, um überhaupt in Ruhe Hausaufgaben zu machen. Hausaufgaben sind meiner Meinung nach sozial ungerecht und so weiter und so fort, ja? Also, die Liste ist endlos leider, an der man aber auch was machen kann. Heißt ja auch, dass man an vielen Punkten ansetzen kann.
[00:19:24] Kristina Appel: Ich habe auch gemerkt, dass es natürlich nicht nur ein deutsches Problem ist. Unsere Österreicher Nachbarn haben auch ein Armutsproblem und ich habe in einem Beitrag auf kontraste.at von einer Mutter gelesen, die armutsbetroffen ist und die sich sehr beschwert hat und hat gesagt, ökonomisch gesehen ist das Nicht-Bekämpfen von Armut so viel teurer als sie zu bekämpfen, aber es wird immer nur in Regierungsperioden gedacht und nicht in Generationen. Wie ordnest du das ein?
[00:19:55] Sirkka Jendis: Ich frage mich manchmal schon, warum es nicht mehr Politiker gibt. Und es gibt sie ja. Es gibt ja auch nicht „die“ Politik. Also ich finde, auch da muss man differenziert gucken. Es gibt auch unterschiedliche Konzepte, die auch zum Teil versuchen, da etwas zu tun. Also ich find zum Beispiel das „Startchancen-Programm“, was jetzt kommen soll und was besonders Schulen mit einem sehr schwierigen Sozialindex helfen soll, ist eine gute Sache. Vielleicht sicher zu wenig, aber ich finde auch immer zu sagen, ist alles zu spät – trotzdem kommt ja was, ist auch gut. In jedem Fall ist es so, dass unser politisches System halt diese Kurzsichtigkeit fördert und es ist einfach so, die Vermögenden-Lobbygruppen, die nehmen auch anderen politischen Einfluss und da sind die Wähler, jedenfalls die vermeintlichen Wähler – wir haben auch eine große Nicht-Wählerschaft unter armungsbetroffenen Menschen – aber ich glaube, und wir sehen es ja ehrlich gesagt auch an Wahlergebnissen, wir müssen ernst nehmen, dass die Menschen sich Sorgen machen, dass sie auch Angst haben, in Armut zu rutschen. Wir müssen diese Ängste auch ernst nehmen und es ist leider noch so ein verbreitetes Phänomen, wenn ich selber Angst habe, absolut nach unten noch mal nachzutreten. Aber genau da, denke ich, müssen wir irgendwie ansetzen. Wir sehen an allen Studien, die Spaltung und die Zukunftsaussichten werden sehr pessimistisch gerade bewertet von allen, und ich denke, wir müssen zumindest versuchen, diesen Zusammenhalt zu stärken. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass auch wohlhabende Menschen mehr davon haben, wenn es weniger arme Menschen gibt im Land.
[00:21:26] Kristina Appel: Jetzt weiß ich auch, dass wir in Deutschland eins der wenigen Länder sind, die zum Beispiel erwirtschaftetes Einkommen höher besteuern als Vermögen oder Einkommen aus Kapitalanlagen. Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, da würde ich mal anpacken?
[00:21:41] Sirkka Jendis: Tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr hohe Vermögensungleichheit haben. Die Einkommensungleichheit ist nicht so hoch, das ist eigentlich so in Ordnung im Verhältnis der Länder, aber bei der Vermögensungleichheit liegen wir im Prinzip ganz kurz hinter der USA. Und ich glaube, viele Deutsche denken, die USA, da ist ja alles so wahnsinnig ungleich. Also wir sind da nicht so weit von entfernt im Bereich Vermögensungleichheit. Na ja, klar, wenn wir über Geld reden und über armutsbetroffene Menschen, müssen wir irgendwo auch auf die ganz andere Seite gehen. Und da gibt es ja auch interessante Konzepte, gerade jetzt jüngst gab es dieses Konzept aus Brasilien, mit zwei Prozent die Superreichen zu besteuern und so weiter. Ich finde das richtig. Wir kommen nicht umhin, auf diese Seite zu gucken und ich finde, da wird sehr, sehr schnell in Deutschland dann so eine Neiddebatte aufgemacht, „die haben das doch alles erwirtschaftet und sind doch Familienunternehmen“. Wir reden aber überhaupt nicht von diesem kleinen Haus, was jemand sich geleistet hat. Oh nein, wir reden wir wirklich von den ganz großen Vermögen. Und auch dieses Narrativ wird gerne aufgemacht. Ja, wir wollen ja dem, der sein Leben lang gearbeitet hat, jetzt noch das Häuschen wegnehmen. Nein, wollen wir nicht, sondern wir wollen auf die Menschen schauen. Vermögen ist ja auch, finde ich, und Erbschaft ist ja so ein… Wir sind doch eine Leistungsgesellschaft, wir halten ja Leistung so hoch, da habe ich ja eigentlich jetzt erst mal nichts geleistet. Am Ende müssen wir natürlich da auch drauf gucken, dass sich da was ändert, ja.
[00:23:06] Kristina Appel: Du hast gesagt, wir erzählen uns immer, dass Menschen, die kein Geld verdienen, faul sind. Dabei ist arm zu sein eins der anstrengendsten Leben, die man führen kann. Kannst du uns vielleicht da noch ein bisschen erzählen, wie man sich das eigentlich vorstellen muss, ohne Geld zu leben?
[00:23:23] Sirkka Jendis: Also wir haben ja so ein bisschen die Narrative schon gestreift sozusagen, dass man eben auch immer dieses Thema hat: Scham. Also, wir wissen zum Beispiel, ich meine, wir haben 14,2 Millionen armutsbetroffene Menschen in Deutschland und zwischen 1,6 und 2 kommen zu den Tafeln. Berechtigt wären also sehr viel mehr. Wir wissen auch, dass nach Corona gerade ältere Menschen, viele nicht wiedergekommen sind. Also das ganze Thema Scham, ich stehe dann da vor der Tafel, man sieht das dann gerade in kleineren Orten, es ist ganz ganz ganz groß und das hält die Leute davon ab und die versuchen wirklich so lange wie möglich irgendwie so eine Fassade aufrecht zu erhalten. Dabei steht Ihnen das ja zu. Wir können nur das helfen, die Ehrenamtsorganisationen, aber sonst stehen Ihnen ja die Leistungen zu. Wir wissen, dass viele diese Leistungen ja gar nicht in Anspruch nehmen. Ich habe dann zum Beispiel mit Menschen gesprochen, die sagen, sie gehen dann halt fünf Stunden einkaufen, weil sie zu fünf verschiedenen Läden gehen, um am Ende 15 Euro zu sparen, weil sie dann die verschiedenen Angebote zusammenholen. Und das ist eben, du hattest es schon gesagt, krank macht arm an und arm macht auch krank. Das heißt, viele haben ja auch mit Krankheiten zu kämpfen, viele sind nicht so mobil, viele wohnen dort, wo auch manchmal die Infrastruktur schlecht ist und wohnen sehr beengt und so weiter und so fort. Und das führt alles dazu, dass das Leben eben wahnsinnig anstrengend ist, wenn man wirklich nicht einfach sagt, ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee und den kaufe ich mir jetzt, sondern wenn man den auch noch umdrehen muss. Positiv kommen natürlich ganz viele zu uns und sind dankbar und freuen sich und kennen sich untereinander, die Kundinnen und die Ehrenamtlichen und suchen das Gespräch und nehmen an Angeboten teil und freuen sich einfach, dass sie sprechen können. Und das kommt auch vor, dass Leute sagen, ich spreche heute das erste Mal am Tag oder das erste Mal in der Woche, weil eben dieses Thema Einsamkeit unter Älteren, und das sind viele der Tafelkundinnen auch einfach, wirklich eine große Rolle spielt, weil man kann ja nicht so viel teilnehmen, weil man ja das Geld dafür nicht hat.
[00:25:26] Kristina Appel: Ich würde gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Wenn ihr die Hand hebt, dann kriegt ihr ein Handmikro. Hier vorne sind direkt zwei, vielen Dank.
[00:25:38] Zuhörerin 1: Vielen Dank. Sie sprechen mir vollkommen aus dem Herzen. Ich vertrete die UNO Flüchtlingshilfe, und Sie haben ja den Bereich Flüchtlinge auch angesprochen. Die Phänomene, die Sie beschrieben haben, Populismus bei der Analyse des Flüchtlingsproblems in Deutschland, ist eins zu eins das, was Sie beschreiben in Bezug auf die Armut. Was ist da für Sie das Kernproblem?
[00:26:04] Sirkka Jendis: Was wir merken, ist, wir sind eben auch mit diesem Populismus auch genau in dem Bereich Geflüchtete und so weiter konfrontiert, weil da wird auch was abgeladen. Das ist das Kernproblem zumindest, was die Tafeln haben. Das kann ich sagen, weil da wurde aus der Politik was abgeladen, weil dann eben erstens entsteht dann der Anspruch, hier bekomme ich ja alles. Und dann müssen wir erst mal erklären, wie das Tafelprinzip funktioniert und daraus wird dann gemacht: Die Geflüchteten wollen ja alles und sind überhaupt nicht bescheiden und dankbar und kommen mit dem SUV und so weiter und so fort. Diese Narrative haben wir auch. Und dann sag ich immer, ja, wenn Krieg ist, flüchten alle. Und dann kommen auch die mit dem Auto, das verkaufen sie nicht noch vorher, um sich… Und trotzdem kriegen wir da natürlich Schwierigkeiten, ehrlicherweise auch, und die muss man auch ehrlich ansprechen, mit den Menschen, die da waren und die zu den Tafeln kommen, die selbstverständlich nicht mit dem SUV kommen. Da kommen auch übrigens kaum sonstige mit dem SUV, aber überhaupt nur im Auto, sagen wir mal überhaupt nur im Auto. Wir versuchen das Problem als Dachverband zu adressieren, auch wirklich an die Politik und wir versuchen den Tafeln zu helfen, da Lösungen zu finden, weil wir auch nicht dafür sind, dass sozusagen getrennte Ausgaben und so, das machen manche Tafeln mal. Tatsächlich haben wir aber auch wirklich eine Agenda verabschiedet gegen Rechtsextremismus, für Vielfalt und versuchen da wirklich auch… Also unser größtes Problem ist die Art und Weise, wie es auf uns abgeladen wird, sozusagen.
[00:27:33] Zuhörerin 2: Danke auch von meiner Seite, dass das Thema heute hier besprochen wird, Lisa Basten von der Ernst-Böckler-Stiftung. Wir sind natürlich auch mit dem Thema eng verbunden und meine Frage geht im Grunde da in die Richtung, auf was für eine Zukunft sie sich vorbereiten. Denn es wurde ja, sie haben beide viel angesprochen, auch an möglichen Stellschrauben. Gleichzeitig sehen wir ja Wahlergebnisse auf der einen Seite, aber auch scheiternde Projekte wie Tariftreuegesetz oder Kindergrundsicherung, alles Dinge, die hätten ja was in Richtung Armutsfestigkeit und Entlastung ihrer Organisation tun können, scheitern alle oder werden so abgeschwächt, dass sie ihre Ziele nicht erreichen werden. Deswegen, auf was bereiten Sie sich vor? Oder ist das, sind, ich sag mal, diese Szenariendenke, machen Sie das? Ist das bei Ihnen drin?
[00:28:19] Sirkka Jendis: Also bei den Tafeln jetzt sozusagen? Ja, also unser größtes oder eines der größten Themen, die wir sehen, ist eben tatsächlich natürlich der demografische Wandel, also das Stichwort die sogenannten Babyboomer. Da vermuten wir schon, dass wir einen großen Zuwachs haben könnten, die zu den Tafeln kommen und das sehen wir schon mit großer Sorge. Wir müssen auch sagen, dass Tafeln sehr, also wir sind so bekannt und dass wir auch wirklich viel Unterstützung kriegen in Krisenzeiten. Also wir haben, als der Ukrainekrieg begann, auch wirklich viele Unterstützung bekommen und wir sind auch ziemlich gut organisiert, dass wir versuchen dann auch wirklich mal, also das ist einfach unglaublich zu sehen, da werden dann eben so Pop-up-Stellen gegründet, die dann in Hauseingängen verteilen und so weiter, um die normalen Ausgabestellen zu entlasten. Also das ist berührend und toll und wir haben auch viel finanzielle Unterstützung dann bekommen, vor allen Dingen auch von privat. Menschen, also nicht staatlich oder sowas, sondern von Privatmenschen, auch von Unternehmen, aber wirklich von Privatleuten auch. Aber wir sehen, man kann jetzt nicht so positiv da drauf gucken, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wir können uns auch gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Wenn ich auf Webseiten von Tafeln gehe, sehe ich eigentlich immer nur: Aufnahmestop. Und dann auch wirklich so Wörter: „Keine Ausnahmen“. Man muss sich das mal vorstellen, da sind dann ja Ehrenamtliche und müssen Leute wegschicken. Das ist schon echt schwierig. Gleichzeitig sagt das dann in dem Moment nichts über das Absolute, sondern erst mal über die Kapazität dieser einzelnen Tafeln. Aber wir sind schon nicht so wahnsinnig optimistisch. Deshalb versuchen wir ja auch politisch mehr aktiv zu werden, haben Tafeln früher nicht so gemacht. Weil wir eigentlich wollen, sozusagen, dass sie nicht mehr so viele Menschen in Anspruch nehmen müssen, aber im Moment denke ich nicht, dass es sehr viel weniger wird.
[00:30:09] Kristina Appel: Sirkka, vielen, vielen Dank.
[00:30:12] Sirkka Jendis: Danke auch.
[00:30:36] Kristina Appel: Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über HerCareer erfahren möchtest, besuche uns im Web unter her-career.com und abonnier den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge der HerCareer Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden HerCareer Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.