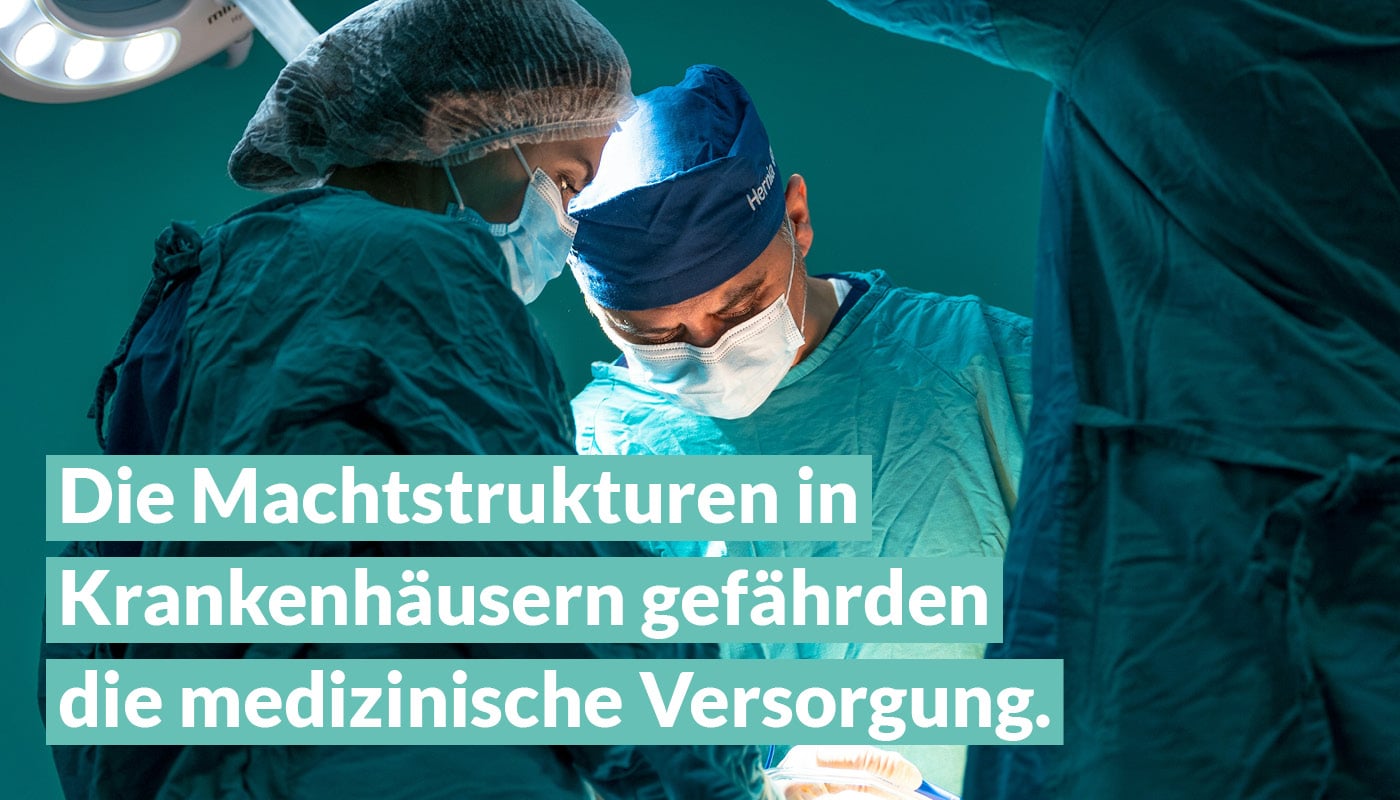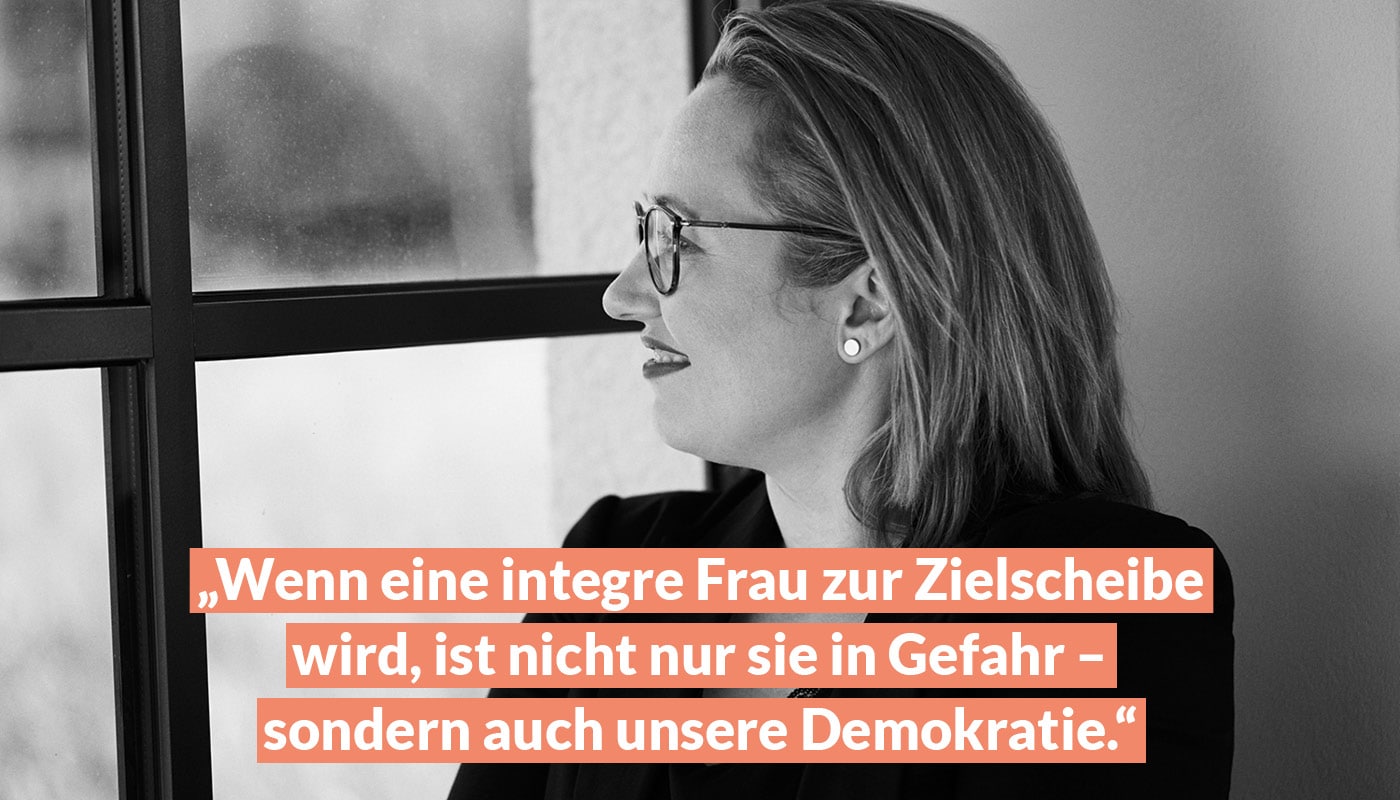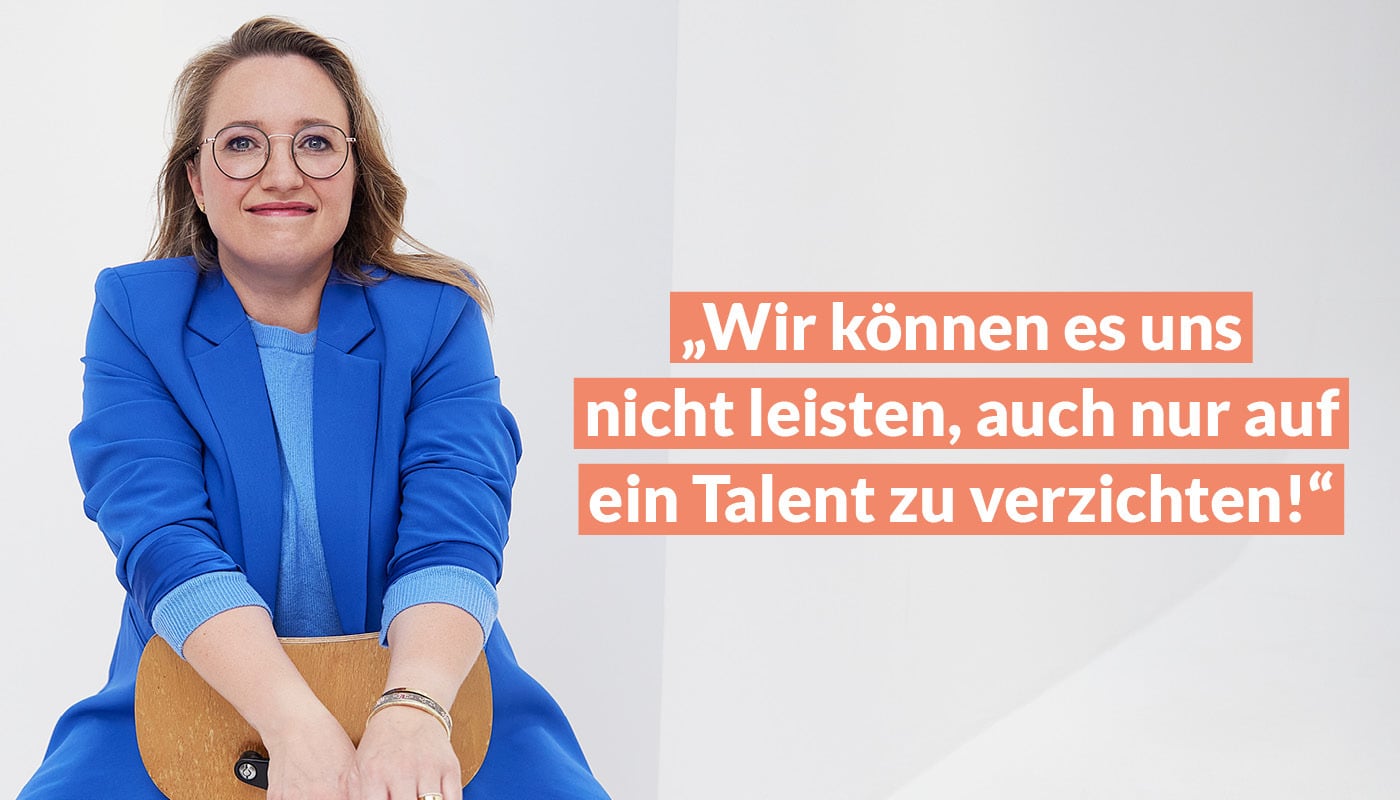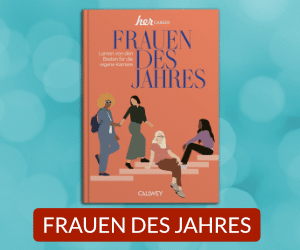„Eine aufstrebende Ärztin wird schwanger. Plötzlich stockt ihre Karriere. Sie ist nicht die Einzige. Wie das Machtgefüge an Unikliniken die medizinische Versorgung gefährdet“ – dazu recherchierte die ZEIT kürzlich.
Sie sprach im Zuge ihrer Recherche mit mehr als zehn Frauen an verschiedenen Kliniken und hörte dabei sehr ähnliche Geschichten. Nur eine der Ärztinnen ließ sich im Artikel namentlich nennen. „Denn wer sich nicht an die ungeschriebenen Regeln des Systems halte, wer den Mund aufmache, verbaue sich seine Zukunft.“
Die Neurochirurgin Kara Krajewski wurde zu Beginn ihrer Karriere noch vom Chefarzt gefördert. Das änderte sich schlagartig, als er erfuhr, dass sie schwanger war. Von da an grenzte er sie aus, behinderte ihr Fortkommen: „Mit einem Mal war ich wertlos, nur weil ich ein Kind kriege.“
In einer Umfrage meinten fast zwei Drittel der 4.700 befragten Medizinerinnen, dass eine Schwangerschaft ihre Karriere behindere – indem sie nicht mehr als gleichwertige Kraft gesehen und nicht für OPs eingetragen werden, keine Oberarztstelle erhalten, Förderungen entfallen u.a. Da ständige Verfügbarkeit erwartet wird (Nacht- und Wochenenddienst eingeschlossen), geraten Mütter mit kleinen Kindern ins Abseits. Krajewski hörte im Kollegenkreis häufig: „Bist du Mama oder Neurochirurgin?“
Ein Chef bot ihr sogar an, sie öfter für OPs einzutragen – wenn sie nackt mit ihm operiere. Laut Studien ist in der Medizin das Problem der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz besonders groß. Mehr als zwei Drittel der Befragten haben solche Grenzüberschreitungen erlebt, meist durch Chefs oder Kollegen.
Der Rechtsanwalt Jan Arne Killmer vertritt Klient:innen im Gesundheitswesen und sagt: Gerade an Unikliniken bauen Chefärzte (durch ihre Professur unantastbar und unkündbar) Herrschaftsstrukturen und Männer-Netzwerke auf. Ausgerechnet dort, wo die besten Köpfe Spitzenforschung vorantreiben sollen und wo an Patienten besonders diffizile Eingriffe vorgenommen werden, herrscht eine Kultur, die Frauen nach draußen treibt. Und sie stellen inzwischen zwei Drittel der dringend benötigten Nachwuchskräfte.
Auf den Artikel hin meldeten sich viele weitere Medizinerinnen bei der ZEIT. Ein paar ihrer Aussagen:
„Einfach nur gute Arbeit zu machen, hilft einem an deutschen Krankenhäusern wenig.“
„Der OP ist heilig – wer drin ist, gehört zum inneren Kreis des Chefs, trinkt mit ihm Espresso und sagt nur, was der Chef hören will.“
„Es vergeht kaum eine OP ohne affige Anspielungen auf Sex oder irgendeine Diskussion über Schwänze.“
„Wer widerspricht, dem droht die stille Sanktion: OP-Verbot.“
„Noch schlimmer finde ich, wie das System zum Wegducken erzieht.“
„Ich habe mich auch an den Betriebsrat gewandt, aber dort sagte man mir: Wenn wir einschreiten, werden Sie hier nicht mehr lang arbeiten können. Der Chef habe genug Wege, mein Leben zur Hölle zu machen.“
„In meiner Zeit an der Universitätsklinik sind neun großartige Chirurginnen und Mütter gegangen, ich bin die zehnte.“
„Wenn wir so weitermachen, wird es bald richtig wehtun – der ganzen Gesellschaft“, sagt die Chirurgin Doreen Richardt im ZEIT-Interview. Sie engagiert sich im Verein „Die Chirurginnen“, der seinen Mitgliedern Hilfe bietet bei Mobbing, Diskriminierung und sexuellen Übergriffen sowie Diebstahl von geistigem Eigentum.
@Dr. med. Nina Hector, Ärztin und Gründerin von doc:Resource, hat ein Pendelmodell für „Verantwortungsparität“ entwickelt, das sie beim Expert-MeetUp auf der @herCAREER Expo am 10.10. vorstellen wird. Das Pendelmodell zielt darauf auf, soziale und berufliche Verfügbarkeiten neu zu strukturieren – als praxisnahes Prinzip, das seine Wirkung auch in schichtgebundenen Betrieben wie Kliniken entfaltet.

Posted by Natascha Hoffner, Founder & CEO of herCAREER | Recipient of the FTAfelicitas Award from Femtec.Alumnae e.V. | LinkedIn Top Voice 2020 | Editor of the “Women of the Year” books published by Callwey Verlag
published on LinkedIn on 12.08.2025