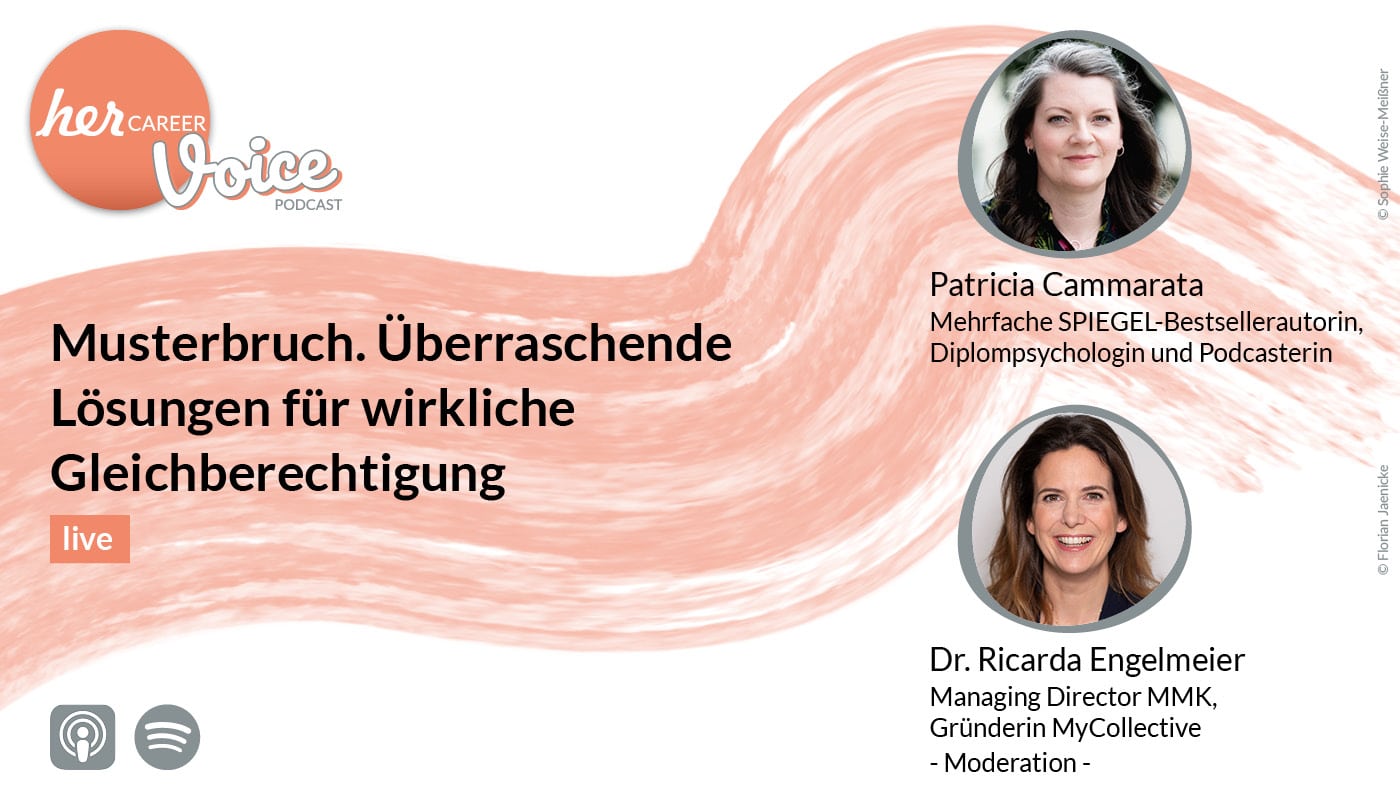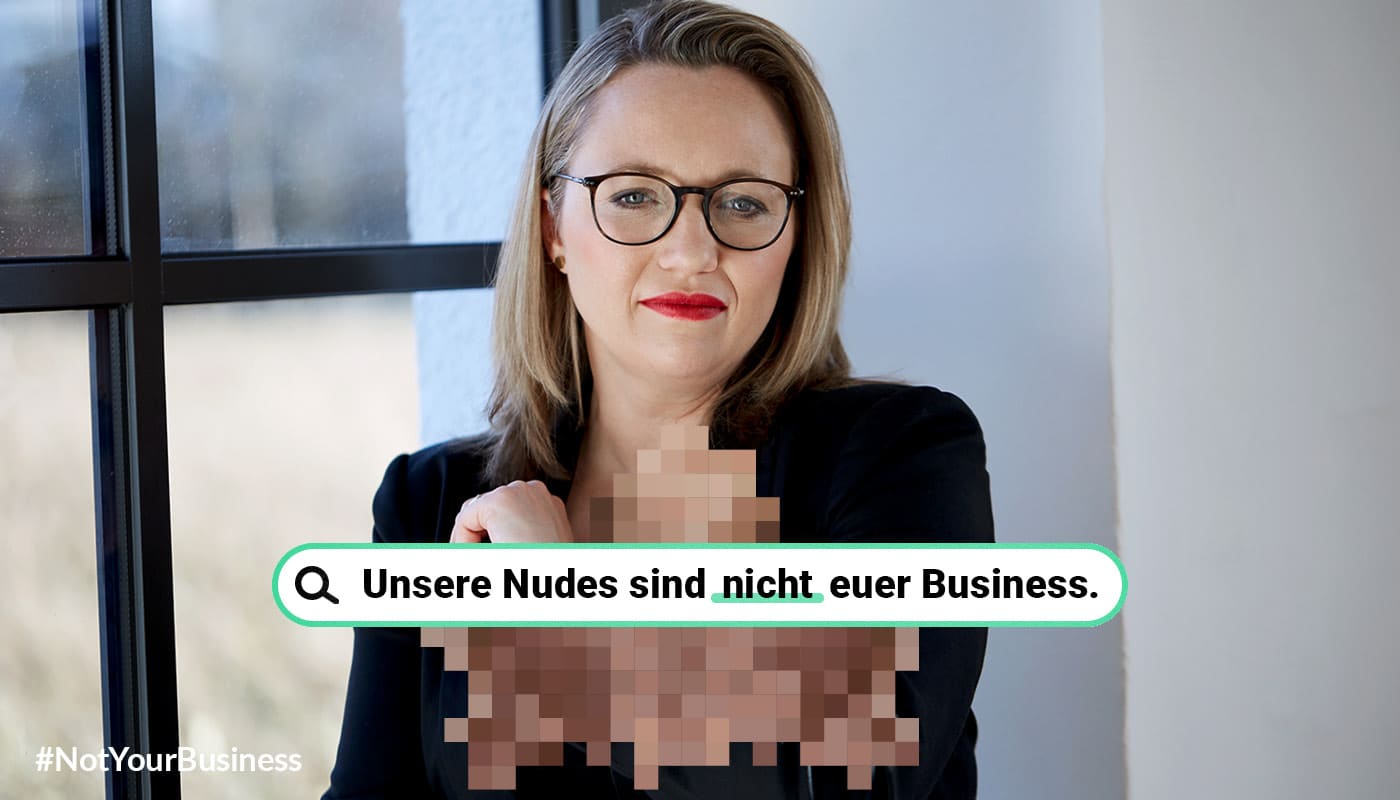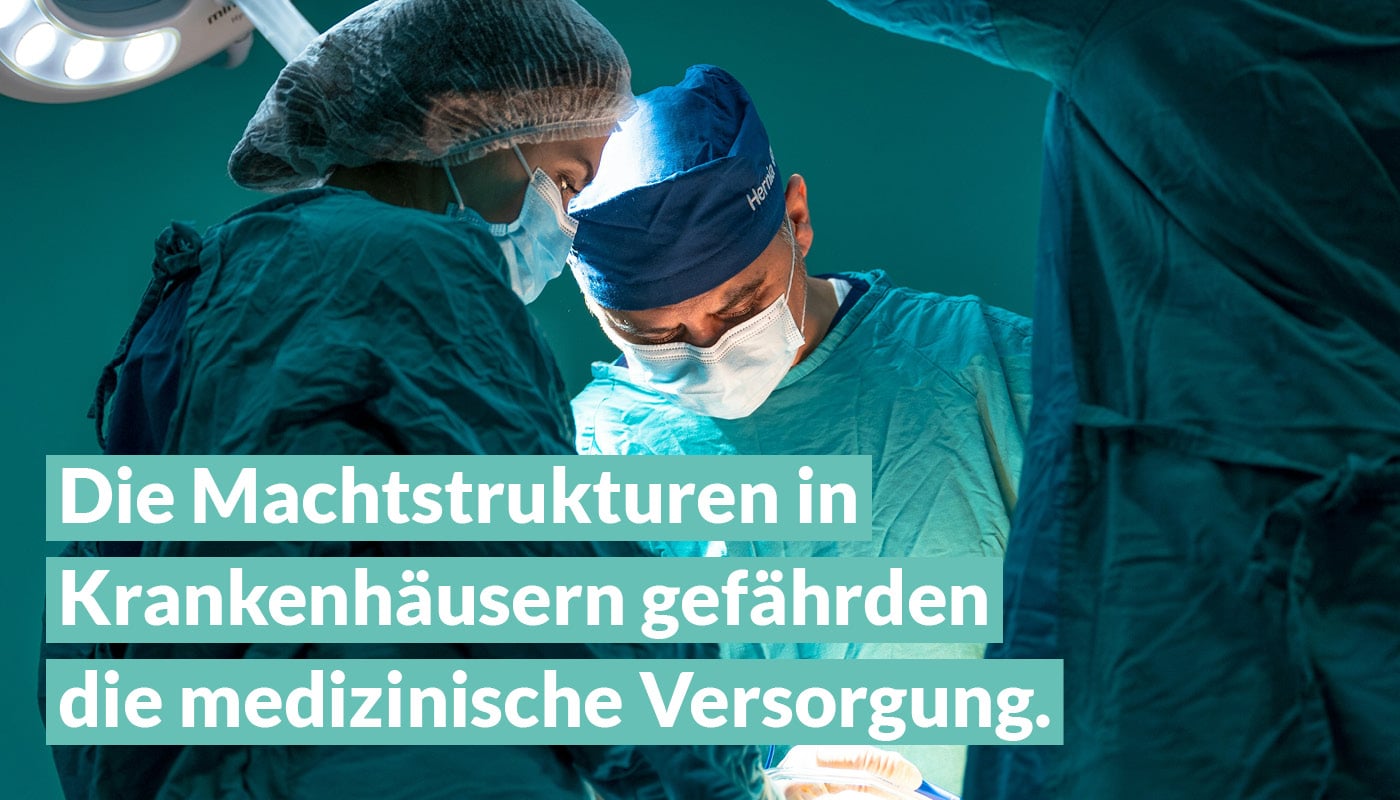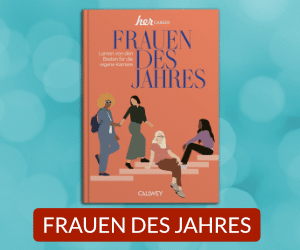Mama hat alle Antworten, Mama findet alles wieder – das sind reine Erzählungen. Wir müssen diese Narrative nicht mit Leben füllen, wir müssen sie nicht weitergeben. Patricia Cammarata, Diplom-Psychologin und Autorin spricht in dieser Live-Aufnahme mit der Gründerin Ricarda Engelmeier über ihr neues Buch „Musterbruch“. Denn genau daruf baut Patricias Vision für eine gleichberechtigtere Zukunft auf – dem Bruch mit erlernten Mustern und Rollenverständnissen. Zunächst in der Partnerschaft und bei der Care-Arbeit. Dann im Recruitingmarkt und in der Unternehmenskultur. Und natürlich in Steuerrecht und Politik. Ein paar Tipps, wie da geht mit dem Auf- und Ausbrechen – und dem Rekonstruieren neuer Supportsysteme, die gibt es natürlich auch.
Mögliche Lösungsansätze, die diese Folge vorschlägt:
Aufteilung der Care-Arbeit
Wie können Paare die Care-Arbeit so aufteilen, dass beide Partner gleichberechtigt sind und keiner benachteiligt wird?
Paare sollten die Care-Arbeit und Erwerbsarbeit gleichmäßig aufteilen, um die Belastung fair zu verteilen und beide Partner zu entlasten. Die Expertin weist darauf hin: „Teilzeit muss ja nicht heißen, dass man 20 Stunden arbeitet, sondern dass beide 80 Prozent arbeiten.“
Konkrete Tipps für Beziehungen und junge Paare
Paare sollten vor der Familiengründung detaillierte Gespräche über die Aufteilung von Care-Arbeit, Erwerbsarbeit und Freizeit führen, um Missverständnisse und Ungleichheiten zu vermeiden. Die Autorin erläutert, dass Eltern in Adoptionsverfahren Fragen wie “wer springt ein, wenn das Kind krank wird?” und “wie verteilen wir die Ferien- und Kita-Schließzeiten?” beantworten können müssen. Dasselbe sollten alle Paare vor der ersten Schwangerschaft untereinander tun.
Politische Maßnahmen
Welche politischen Änderungen sind notwendig, um echte Gleichberechtigung zu erreichen und wie können diese umgesetzt werden? Lösungsansatz: Politische Maßnahmen wie die Abschaffung des Ehegattensplittings und die Einführung einer 35-Stunden-Woche können strukturelle Ungerechtigkeiten abbauen und die Gleichberechtigung fördern. „Wir brauchen schon die richtigen Rahmenbedingungen,” betont Patricia Cammarata, “weil wir nur in diesen agieren können.“
Weitere Tipps in der Folge!
Thema
Familie & Vereinbarkeit | Gesellschaft
Angaben zur Referentin
Patricia Cammarata ist Diplompsychologin und gefragte Keynote-Speakerin zum Thema Vereinbarkeit und Gleichberechtigung. Mit ihrem SPIEGEL-Bestseller »Raus aus der Mental Load Falle« machte sie den Begriff Mental Load im deutschsprachigen Raum bekannt und hat eine breite gesellschaftliche Debatte zum Thema Gleichberechtigung angestoßen. Für ihr Blog »dasnuf« gewann sie zahlreiche Preise, ihre Podcasts »Mit Kindern leben« und »Nur 30 Minuten« werden von mehreren Tausend Menschen gehört. Mit ihren Kindern und ihrem Partner lebt sie in Berlin.
Angaben zur Moderatorin
Dr. Ricarda Engelmeier hat Politik und Wirtschaft studiert und in Betriebswirtschaft promoviert. Sie begann ihre Karriere in einer Strategieberatung in Deutschland und wechselte dann zur GIZ in Indien. Von Neu-Delhi aus arbeitete sie sieben Jahre lang an wirkungsorientierten Geschäftsmodellen in Asien, was zum Aufbau einer unabhängigen Institution für verantwortungsvolles Wirtschaften führte. Anschließend wechselte sie zur Siemens AG in München, in die Unternehmensstrategie mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Während ihrer dritten Elternzeit gründete Ricarda/Frau (Dr.) Engelmeier MyCollective: ein Programm zur Unterstützung von Männer und Frauen während und nach der Elternzeit und von Unternehmen hinsichtlich der Erreichung von Diversitätszielen und der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Ihr Herzensanliegen, dass alle Eltern das richtige Arbeits-, Betreuungs- und Metal Load Modell finden und sich sowohl beruflich als auch privat verselbstwirklichen können.
Der Beitrag wurde im Rahmen der herCAREER Expo 2024 aufgezeichnet und als Podcast aufbereitet.
[00:00:00] Patricia Cammarata: Teilzeit muss ja nicht heißen, dass man 20 Stunden arbeitet, sondern das kann ja heißen dass beide 80 Prozent arbeiten, und dann ist es halt sehr viel handelbarer auch. Das Geheimnis ist einfach, dass man es nicht mehr ungerecht, also die Nachteile nicht mehr ungerecht aufteilt, dann zum Nachteil der Frauen, sondern dass man sagt, die Nachteil kann es geben, aber die teilen wir uns auf und wir stellen uns aber dadurch ja auch viel resilienter auf.
[00:00:41] Kristina Appel: Willkommen beim HerCareer Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen? Dann bist du hier genau richtig. Der viel gefeierte Mutterinstinkt, der ist ein Märchen. „Mama hat alle Antworten. Mama findet alles wieder.“ Das sind reine Erzählungen. Wir müssen diese Narrative nicht mit Leben füllen. Wir müssen sie auch nicht weitergeben. Patricia Cammarata, Diplompsychologin und Autorin, spricht in dieser Live-Aufnahme mit der Gründerin Ricarda Engelmeier über ihr neuestes Buch „Musterbruch“. Denn genau darauf baut Patricias Vision für eine gleichberechtigtere Zukunft auf: auf dem Bruch mit erlernten Mustern und Rollenverständnissen. Zunächst in der Partnerschaft und bei der Care-Arbeit, dann im Recruiting-Markt und der Unternehmenskultur und natürlich auch in Steuerrecht und Politik. Ein paar Tipps, wie das geht mit dem Auf- und Ausbrechen und dem Rekonstruieren neuer Support-Systeme, die gibt es natürlich auch.
[00:01:59] Ricarda Engelmeier: Ich freue mich unglaublich, dass wir heute hier sind und so viele tolle Zuhörer haben und wahrscheinlich auch Leserinnen deines ersten Buches. Ich würde trotzdem dich mal kurz vorstellen. Patricia sitzt hier neben mir, ihr kennt sie als Autorin von „Raus aus der Mental-Load-Falle“, deinem ersten super Knallerbuch und vielleicht kennt ihr Patricia auch von ihrem Blog „Nuf“, mega cool, ihre Inspirationen durchgehen, man kann also während du zwischen Büchern mal kurz Pause machst, da mal ein bisschen so lesen, was gerade so los ist. Und jetzt bist du hier mit deinem neuen Knaller Buch „Musterbruch“. Spiegel-Bestseller, ich freue mich unglaublich und ich habe mich für dich in Lila angezogen.
[00:02:41] Patricia Cammarata: Sehr, sehr gut, vielen Dank!
[00:02:45] Ricarda Engelmeier: Schön, dass wir sprechen. Ich freue mich unglaublich. Vor allem, weil ich heute Morgen beim Frühstück einen Hausgast bei uns zu Hause hatte und sie meinte, ah, ihr sprecht über die Mental-Load-Falle. Und was machst du dann genau dabei, Ricarda? Und dann meinte ich so: ja… Meinte sie so: Berichtest du dann aus der Perspektive von der Falle heraus? Das heißt, wir können alle lernen. Ich glaube, jeder sitzt mal in dieser Falle, das ist das eine. Aber jetzt heute sprechen wir über Musterbrüche. Ging es denn nicht weit genug nach deinem letzten Buch, sodass du jetzt noch eins hinterher schieben musst mit der Gleichberechtigung?
[00:03:19] Patricia Cammarata: Also tatsächlich habe ich erst mal nach der Mental-Load-Falle gedacht, es ist alles zu dem Thema gesagt. Es gibt ja auch andere tolle Autorinnen, so wie die Laura Fröhlich beispielsweise. Dann habe ich sehr viele Vorträge gehalten und habe festgestellt, ah, da wiederholen sich so ein paar Fragen immer und immer wieder. Und daraus ist letztendlich „Musterbruch“ entstanden. Nämlich, wenn man erst mal quasi so verstanden hat, es gibt ein Ungleichgewicht, speziell dann eben auch im Mental-Load ist ja die große Frage immer, ja, aber wie kann man das eigentlich ändern? Also es fließt ja in ganz viele Lebensbereiche eben rein, die das beeinflussen. Und deswegen wollte ich nochmal was Konkreteres mit in die Hand geben und habe mir angeguckt eben in verschiedenen Lebensbereichen, wo spielt das eine Rolle? Und dann aber vor allem auch, was können wir tun? Und auch für alle, die quasi nicht so viel Zeit haben, wenn man eben viel Care-Arbeit ja hat und Erwerbsarbeit nebenher. Es ist immer am Ende auch so zusammengefasst, dass man möglichst was mitnehmen kann, was wirklich praktisch ist.
[00:04:22] Ricarda Engelmeier: Was ist denn genau dieser Zusammenhang zwischen der Mental-Load-Falle und diesen Geschlechterrollen oder diesen Mustern? Wie ist da die Brücke? Wie siehst du die?
[00:04:30] Patricia Cammarata: Die Brücke ist, dass wir in unserer Sozialisation ja ganz stark lernen, dass Frauen gut im Kümmern sind. Oder wir haben so gesellschaftliche Vorstellungen, wie: Die Mutter ist das Beste fürs Kind. Und obwohl es dafür eigentlich keine strenge biologische Grundlage gibt, verhalten wir uns ja so, also wir Frauen, ja auch ein bisschen so im vorauseilenden Gehorsam, um diese Bilder ja auch zu erfüllen, aber auch die Gesellschaft quasi macht ja den Druck von außen. Und dadurch ist eben Mental Load ein Phänomen, was vor allem Frauen betrifft. Also an sich ist ja Mental Load einfach ein Teil von unserem Leben. Also das ist ja… Man antizipiert irgendwie, was ist gerade los, dann überlegt man, was habe ich für Möglichkeiten darauf zu reagieren, dann entscheidet man, dann setzt man um, also ganz neutral müsste es ja eigentlich so sein, dass es Männer wie Frauen quasi für die Alltagsführung auch gleichermaßen haben, aber praktisch zeigt ja die Statistik, dass das nicht so ist. Und das liegt natürlich ganz stark eben an der Sozialisation und an unseren Rollen, die wir immer wieder reproduzieren von Generation zu Generation.
[00:05:38] Ricarda Engelmeier: Diese Rollen, ich meine, wir kennen sie alle, du sprichst hier vor einer Reihe von Frauen, die wahrscheinlich diese Mental-Load-Falle auch durchlebt haben. Wie wird diese Rolle einem denn weitergegeben? Woher kommt es?
[00:05:49] Patricia Cammarata: Ja, also was man schon mal sicher sagen kann, das ist nicht in unserer DNA und es gibt auch keinen Mutterinstinkt, sondern es wird wirklich reproduziert. Das wiederholt sich eben von Generation zu Generation, weil heutzutage auch meistens die Mütter diejenigen sind, die die ersten Lebensjahre mit den Kindern verbringen, und wenn man das jetzt mal psychologisch quasi sehen möchte, ganz schneller Abriss quasi, ist es so, dass Kinder sich erst mal natürlich mit der Mutter identifizieren. Jungs wie Mädchen. Das heißt, die gucken, was lebt die Mutter vor? Wenn die also diejenige ist, die sich kümmert, die alles im Kopf hat, die alle Antworten auf alle Fragen hat, dann richten sich die Kinder erst mal nach der Mutter. Und die hat eben dieses innere Familienleben, das nach innen gerichtete, das gefühlsbetonte. Und der Vater, er ist autonom. Er hat die Erwerbswelt als Thema und geht quasi nach außen. Und wenn die Kinder dann ranwachsen, dann denken die, oh, das ist ja eigentlich ganz attraktiv, quasi diese Freiheiten zu haben, das Geld zu haben und so weiter, und orientieren sich erst mal am Vater. Und der Vater macht dann plötzlich was, was quasi geschlechtsspezifisch anders ist. Also dem Sohn sagt er so: Du bist wie ich, du kannst dich so entwickeln. Und den Mädchen sagt er: Ne, ne, Moment, du bist ja ein Mädchen, du bist nicht wie ich – und schickt quasi die Mädchen zurück zur Mutter. Und die retten dann quasi ihren Wunsch nach Autonomie darin, dass sie sagen, aha, ich kann also nicht sein und mich verhalten wie ein Mann, aber ich kann wenigstens vielleicht einen Mann haben und dann sozusagen ein bisschen davon abhaben. Und dadurch quasi fängt man sehr, sehr früh an, als Mädchen sich eben ganz stark auf Männer auszurichten, auf Kümmern auszurichten, auf Gefühlsmanagement, auf Harmonie Herstellen. Weil man versucht, da eine Verbindung herzustellen. Und das passiert eben weiterhin, solange unsere Familien so sind, dass vor allem die Mütter die ersten Lebensjahre die Betreuung übernehmen, geht es immer wieder in die nächste Generation weiter. Das heißt, wir können das wirklich erst durchbrechen, wenn die Väter relevant große Anteile an der Sorgearbeit vor allem in den ersten Jahren auch übernehmen. Weil wir dann lernen: Das ist nicht genetisch, sondern das ist was, was wir lernen. Das ist eine Kompetenz, die wir aufbauen.
[00:08:15] Ricarda Engelmeier: Also das Thema Männer, jetzt gehen wir mal auf die Männer ein. Also du sagst, Männer sollen mehr Elternzeit in den ersten Jahren nehmen. Ich bei „MyCollective“ fokussiere mich ja auf die Elternzeit. Das sind ja die ersten Jahre, so. Und wir haben sehr, sehr viel investiert, immer mehr Männer ranzugeben. Wir arbeiten B2B, das heißt von Unternehmen, die dann auch sagen, wir haben Elternzeitler, Männer und Frauen, und die sollen unterstützt werden. Wir haben gesagt, wo sind sie denn, die Männer? Können wir vielleicht noch mal mehr einladen? Können sie das vielleicht incentivieren, bis hin zur finanziellen Incentivierung? Und die Sache ist die, dass die Männer in Deutschland ja durchschnittlich knapp über zwei Monate Elternzeit nehmen, 2,1 Monate Elternzeit, das meistens aufgeteilt auf jeweils einen Monat und den immer im August parallel zum Partner. Und meistens mit einem VW-Bus in Marokko. Also das ist ja total schön, aber de facto die Statistik zeigt ja, dass es nicht so ist. Wenn man irgendwie in Berlin-Mitte rumläuft, dann denkt man, aha, hier sind ganz viele Männer mit rosa Socken und goldener Nickelbrille und schieben Kinderwagen, das ist alles toll. Aber de facto, die Statistik zeigt ja, dass es sich nicht verändert. Wie kriegt man denn die Männer dazu?
[00:09:20] Patricia Cammarata: Es ist tatsächlich so, knapp 60 Prozent der Männer, die nehmen ja auch heutzutage immer noch keinen einzigen Tag Elternzeit, aber es hat sich schon was bewegt, also seit Einführung des Elterngeldes hat sich was bewegt, das finde ich ist immer wichtig zu wissen. Und das Zweite ist, wie kriegen wir die Männer dazu, finde ich, ist immer so eine sehr traurige Frage eigentlich, weil niemand fragt, wie bekommen wir eigentlich die Frauen dazu, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und ich kenne auch die Statistiken, wo Männer befragt werden, wie wichtig ihnen Gleichberechtigung ist. Und das drittelt sich. Also es gibt ein Drittel der Männer, die wirklich sagen, ich bin bereit, was zu tun auch, meine Privilegien abzugeben, aus meinem Rollenbild auch auszubrechen. Ein Drittel der Männer sagt, naja, solange das nicht irgendwie so in mein Leben Einfluss nimmt, können die Frauen ruhig ihr Zeug machen. Und ein Drittel sagt halt ganz klar: Ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, solche Aufgaben zu übernehmen. Und deswegen finde ich, will ich diese Frage gar nicht mehr beantworten, wie kriegen wir die Männer motiviert. Sondern vielleicht liegt die Antwort in ganz anderen Themen. Wir sind 50 Prozent Frauen, wenn wir Gleichberechtigung wollen und wir sehen irgendwie, da tut sich jetzt nicht mehr so viel wie bei den Männern, ist vielleicht, dass man dieses Thema hinter sich lässt und sagt, wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, was wir als Frauen miteinander und untereinander auch erreichen können. Und dann kommt man auf ganz andere Modelle, also wo wir eben bei dem Konkreten waren. Ich befasse mich beispielsweise mit der Frage, wie Wohnen auch Einfluss auf Gleichberechtigung nimmt. Weil das ist ganz absurd. Muster, in dem wir leben, mit dem Verliebt-verlobt-verheiratet, Zusammenziehen ist ja irgendwie in unseren Köpfen, ach dann wird ja alles einfacher und wir haben dann weniger Arbeit. Aber Fakt ist, weniger Arbeit haben die Männer, und die Frauen haben mehr Arbeit. Das heißt, was passiert ist eben, dass wir in diesen Modellen irgendwie uns die Arbeit sozusagen reinholen. Und es gibt eben auch zum Beispiel in Südamerika ganz andere Modelle oder auch in der Pandemie hat es unter Alleinerziehenden in Amerika immer mehr Momunities quasi gegeben, wo Frauen zusammengefunden haben und gesagt haben, wir haben eine Care-Verantwortung, wir kriegen das aber nicht gewuppt, aber wie können wir zusammenleben und das machen unter Schwestern, unter Tanten, mit Müttern, mit Freundinnen und eben weg von diesem heteronormativen Bild. Und das schmerzt natürlich, weil wir jetzt sagen: Moment, mal soll ich jetzt mit meiner Freundin zusammenziehen? Aber da liegen schon wirklich Antworten, auch im Kleinen. Also Frauen zum Beispiel haben Probleme, ihre Wohnung selber als Freizeitort wahrzunehmen. Weil sie haben einen Erwerbsarbeitsort und sie haben den Care-Arbeits-Ot, aber sie haben keine Freizeiträume. Für Männer ist die private Wohnung Freizeitaum. Das heißt, auch da im Kleinen können wir gucken, wie schaffen wir, dass es in unseren Wohnungen Freizeiträume für uns Frauen gibt, wo man eben wirklich mal abschalten kann. Da versuche ich eben mehr reinzugehen, weg von diesem Konventionellen und wirklich einen großen Blumenstrauß anzubieten, weil es ist dann natürlich nicht für jeden, dass man sagt, ich will dann nicht mit meinem Mann zusammen wohnen, sondern zieh mit meinen Freundinnen zusammen. Aber es gibt ja immer Abstufungen davon. Deswegen glaube ich, dass bei der Gleichberechtigungsfrage vielleicht wirklich, also wir da weg müssen von diesen, also muss das Elterngeld noch erhöht werden und so weiter, weil das führt einfach zu nichts. Also dieses Argument auch, mit dem: Ich kann keine Elternzeit machen, weil ich hier nur höchstens 1800 Euro bekomme – das ist ein männliches Argument. Frauen, die Vielverdienerinnen sind, die teilweise auch die Familie alleine versorgen, die machen trotzdem Elternzeit. Und die geben sich dann mit den 1800 Euro zufrieden, in Anführungszeichen, und die Argumentation dreht sich rum. Wenn der Mann wenig oder gar nichts verdient, dann sagt die nicht, du musst jetzt Elternzeit machen, weil das lohnt sich ja nicht, wenn ich Elternzeit mache, sondern sie sagt, wie toll ist es denn, jetzt kann ich Elternzeit machen. Und du kannst die Zeit nutzen, um dich zu qualifizieren, einen Job zu finden, quasi eine Karriere anzufangen. Und dann haben wir dann nicht mehr diesen Gap. Und das funktioniert ganz anders, wenn der Mann der Vielverdiener ist. Und daraus kann man eben schließen, es hängt halt sehr stark an den Rollen und gar nicht so sehr am Geld. Und Männer sind dann sehr wahrscheinlich, auch wenn man das Elterngeld noch anhebt, trotzdem nicht bereit, relevant länger Elternzeit zu machen.
[00:14:16] Ricarda Engelmeier: Hier sind ja auch viele, die noch nicht in der Familiengründungsphase sind und sich vielleicht noch überlegen, also diejenigen von euch, die sich das jetzt überlegen, jetzt zuhören. Drei konkrete Tipps für ein junges Paar, was sie denn machen können, damit sie nicht in diese Falle und nicht in diese Rollen reinrutschen.
[00:14:32] Patricia Cammarata: Es erwarten dann ja immer alle so den Knallertipp, da hat noch nie jemand dran gedacht und das hilft in allen Situationen, die habe ich natürlich nicht. Aber die gute Nachricht ist, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, weil die Studien zeigen, dass wir eben viel zu wenig das Konkrete miteinander bereden und dass wir dann langsam eben in so eine Ungleichverteilung rutschen. Was wir aber eigentlich machen müssen, ist, bevor man ein Kind kriegt, ganz konkret alles miteinander besprechen. Also wie sieht das nicht nur in der Elternzeit und da mit dem Geld aus, sondern welche Folgen hat das in drei, in fünf, in zehn Jahren? Wie sieht das aus mit dem Kindergarten? Wer wird denn im Meeting um 16.30 Uhr den Stift fallen lassen, weil die Schließzeit um 17 Uhr ist? Und da hat man ja je nach Bundesland auch noch Glück, wenn man den Kindergarten bis 17 Uhr hat. Wer wird die Krankentage übernehmen, wer wird die Schließtage übernnehmen, was ist, wenn wir keinen Hort haben? Wer wird aus dem Schulranzen die Zettel ziehen, wo steht, dass man jetzt morgen zehn Rollen Klopapier zum Basteln braucht und übermorgen irgendwie einen Kuchen? Also wir bereden das wirklich eben nicht so im Detail und deswegen kann ich immer nur ermutigen, diese Gespräche wirklich zu führen und was ich als Hilfe im Buch übernommen habe, was ich wirklich wahnsinnig interessant finde, wenn man adoptiert, also wenn man ein Kind adoptiert, dann wird man mehrere Gespräche in dieser Form führen, vom Amt aus, wo eben nicht nur diese 12 Monate oder 14 Monate Elternzeit abgefragt werden, sondern wirklich ganz konkret gefragt wird, was ist eure Motivation, wie wird sich euer Leben verändern? Wie werdet ihr damit umgehen? Also ich habe einfach alle Fragen, die in diesen Bögen quasi sind, da mit abgedruckt. Das war für mich total augenöffnend, dass sozusagen die Paare, die heteronormativ leben und selber biologisch Kinder kriegen, die machen das ja so mehr oder weniger, dass man sagt, ja wir wollen ein Kind, ja ich auch. Und wie wollen wir die Elternzeit machen? Ja du zwölf Monate, ich zwei, weil wir sind ja modern. Und dann ist das Gespräch im Wesentlichen irgendwie beendet. Und das ist ja völlig absurd, weil wir eine Entscheidung treffen, nicht nur über Wahnsinnsinvestitionen. Kinder kosten bis zum 18. Lebensjahr 120.000 Euro, aber auch, was es uns Frauen im Durchschnitt kostet. Männer verdienen im Laufe ihres Lebens 1,3 Millionen Euro durchschnittlich, Frauen 720.000 Euro. Also klar kosten Kinder Geld, aber wen kosten sie was? Und was entwickelt sich daraus? Und ich glaube, das erscheint so banal, aber wir tun es nicht. Wir sprechen nicht konkret und wir bleiben auch nicht regelmäßig im Gespräch. Und das ist auch ganz schwierig. Also ich habe auch ein Kapitel über miteinander Reden und über Zwiegespräche geschrieben, weil was ja oft passiert ist, dass sich Frust aufstaut und dass man dann irgendwann wirklich nicht mehr in der Lage ist, konstruktive Gespräche zu führen. Und das kann man auch abfedern, indem man regelmäßig auf eine bestimmte Art und Weite miteinander eben spricht, damit sich das nicht so entwickelt, dass man in jedem Gespräch irgendwie denkt… Ich will eigentlich meinem Partner erstmal ein bisschen würgen, bevor wir zu konstruktiven Lösungen kommen. Da haben wir einfach auch keine Kultur, weil wir sagen, die Liebe, da lesen wir uns die Wünsche von den Augen ab und so. Also diese romantischen Ideale sind nicht hilfreich im konkreten Alltag, wenn man Gleichberechtigung möchte.
[00:18:13] Ricarda Engelmeier: Das heißt, man findet eine Liste sozusagen mit Sachen, die man auch schon beim ersten Date vielleicht abfragen könnte. Oder senken wir dann hiermit die Geburtenrate radikal in Deutschland.
[00:18:24] Patricia Cammarata: Es ist zu befürchten, dass man das empfehlen soll, aber im Grunde ja, weil es hilft ja nicht. Also das wird ja wirklich bis zur sogenannten Rushhour des Lebens immer schlimmer. Also wenn ich Vorträge halte und auch über den „Gender Care Gap“ spreche, der ist bei den 35-jährigen Frauen, die ein Kind haben, die machen im Schnitt, also wirklich, im Schnitt 111 Prozent mehr Care-Arbeit als ihre Partner. Und dann sehe ich immer so eine Mischung aus Entsetzen und Erleichterung, weil viele Frauen in dieser Rushhour total erschöpft sind und immer denken, das ist individuell, das bin ich alleine, ich krieg das nicht geregelt. Und es ist leider wirklich aus dem System heraus und auch wenn wir in Partnerschaften wirklich das Beste uns wünschen. Wenn wir bestimmte Dinge nicht aktiv tun, dann landen wir da. Und dann ist halt so die Frage, wie verhindert man dann, dass wirklich viele Frauen auch so knapp in dieser Lebensphase an einem Burnout vorbeischlittern? Das ist ja wirklich nicht wünschenswert.
[00:19:32] Ricarda Engelmeier: Ich habe auch ziemlich viel Nicken hier so im raum gesehen, ich glaube einige von euch kennen die Rushhour des Lebens. Du hattest das thema Geld auch noch mal angesprochen. Ich würde sagen, lass uns doch da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast gesagt, das kostet was. Was war das jetzt? Das Gap war zwischen 700.000 und 1,2 millionen – was ist das denn alles? Es ist Einkommen, es ist Karrierechancen, es ist Rente. Was kann man dagegen machen?
[00:19:56] Patricia Cammarata: Natürlich muss man auch über Geld sprechen, aber wenn wir jetzt quasi fair sind, wir sind jetzt wahrscheinlich hier nicht der Kreis, wo es irgendwie wirklich ums Überleben geht. Solche Familien gibt es natürlich auch. Aber Kinder, die erscheinen ja auch nicht einfach, sondern es dauert ja in der Regel wirklich durchschnittlich auch zwei Jahre, bis man überhaupt schwanger wird. Das heißt, wenn man einen Kinderwunsch hat und so ein Gehaltsgefälle quasi dann zu erwarten ist bzw. dann auch der Partner schon sehr viel mehr verdient als diese 1800 Euro, dann kann man einfach ganz banal wirklich vorsparen und man muss es auch tun. Der Hebel ist, über Zeit zu verhandeln. Dass man sagt, wie kann man die Ressourcen zeit-fair verteilen. Und zwar einmal zu den Kindern, also Beziehung zu dem Kind, dann zur Erwerbsarbeit und zur Karriere. Und das Dritte ist quasi alles Richtung Freizeit und Selbstverwirklichung. Und dann rückwärts planen, also aus diesem Dreieck zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass jeder von uns Zugang im gleichen Maße zu diesen drei Themen hat. Und dann zeigt sich ja eben sehr schnell, dass man dann Care-Arbeit eben auch miteinander aufteilen muss. Aber da ist es vielleicht auch hilfreich wirklich zu sehen, man verzichtet ja, oder die Männer verzichten ja dann auch zum Beispiel auf Beziehungen zum Kind durch diese Erwerbsarbeitszentrierung. Und man hat dann in bestimmten Lebensphasen ja dieses Phänomen, dass die Kinder, gerade auf Instagram gibt’s sehr lustige Videos, die Kinder stehen quasi direkt am Papa vor dem Kühlschrank, die Mutter ist einen Raum weiter und ein Kind ruft: Mama, ich hab Durst! Also erstens total belastend für die Mutter, quasi ständig zuständig zu sein, aber es ist ja auch total deprimierend für den Vater. Und das kommt aber ja aus dieser Erfahrung, die die Kinder machen, dass die Mütter immer da sind, dass sie alles wissen, sich auskennen, der Vater eben oft auch abwesend ist. Und ich glaube, wenn man sich solche Situationen so ein bisschen vor Augen führt, öffnet sich so ein bisschen der Blick, dass halt das Geld also nicht alles ist, und vor allem auch eine Elternzeit ja zwölf bis 14 Monate einfach dauert, und was danach kommt, ja auch höchst relevant ist. Und das ist kompliziert, aber es gibt ja auch „ElterngeldPlus“ beispielsweise, womit man sich da mal befassen kann. Dass es dann nicht ist, dass man komplett aus dem Job raus ist, sondern eben auch weiter was verdient etc. Also man muss über diese Standardmodelle hinaus denken. In der Alltagssprache heißt es ja „Partnerschaftsmonate“. Und es gibt wirklich ganz viele Menschen, die glauben, Männer können nur zwei Monate Elternzeit nehmen, die das nicht wissen und deswegen auch gar nicht in Erwägung ziehen, dass man das anders machen kann.
[00:22:50] Ricarda Engelmeier: Wenn man jetzt wieder mal die Statistiken anschaut und nicht nur die einzelnen Beispiele, die wir vielleicht aus unserer Bubble kennen, dann sind 7 Prozent aller Väter in Teilzeit und 66 Prozent aller Frauen in Teilzeit. Das heißt, die Männer gehen den Karriere-Bummer nicht ein sozusagen und auch nicht diese Teilzeitfalle, weil sie gesehen haben, auf der anderen Seite, Frauen, die das machen, zahlen den Preis dafür. Andersrum, wenn Frauen jetzt nicht mehr den Preis zahlen würden, macht es das dann attraktiver?
[00:23:19] Patricia Cammarata: Ich glaube, man würde sich die Nachteile einfach gerechter aufteilen, und man hat, glaube ich, auch den Vorteil, dass wir ja jetzt schon einen drastischen Fachkräftemangel haben und in zehn Jahren die Babyboomer alle in Rente gehen und sich das Ganze dann so entwickeln wird, dass Arbeitgeber sich gar nicht mehr leisten können, irgendwie Menschen zu diskriminieren, weil sie nur 32 Stunden oder 30 Stunden arbeiten. Auch hier ist es übrigens so, Teilzeit muss ja nicht heißen, dass man 20 Stunden arbeitet, sondern das kann ja heißen, dass beide 80 Prozent arbeiten und das ist ja, je nachdem wie quasi die Vollzeitstelle ist, sind das ja dann zwischen 30 und 32 Stunden. Und dann ist es halt sehr viel handelbarer auch, wenn man das auf vier Tage verteilt. Dann hat man schon mal zwei Tage, wo man quasi immer jemanden hat, der sich kümmern kann. Und da darf man dann wahrscheinlich nicht so absolut denken. Aber das Geheimnis ist einfach, dass man es nicht mehr ungerecht, also die Nachteile nicht mehr ungerecht aufteilt eben, dann zum Nachteil der Frauen, sondern dass man sagt, die Nachteile kann es geben, aber die teilen wir uns auf und wir stellen uns aber dadurch ja auch viel resilienter auf. Das heißt, wenn die Frau auch ein Einkommen generiert, dann ist auf der anderen Seite, dann muss ein Mann heutzutage nicht mehr bei einem Arbeitgeber bleiben, der überhaupt gar kein Verständnis für familiäre Verpflichtungen hat, sondern der kann einfach sich umgucken und sagen, wie hier, es gibt also nicht nur eine Handvoll, sondern viele Hunderte Arbeitgeber, die das schon mal ein bisschen weiter gedacht haben. Und das wird in Zukunft, also da bin ich wirklich zuversichtlich, besser werden. Also, weil ich werde ganz viel von Unternehmen gebucht, was ich am Anfang gar nicht verstanden habe. Warum interessieren die sich alle für Care-Arbeit? Aber die bereiten sich einfach vor auf den Fachkräftemangel, der schon da ist und der noch stärker wird. Der demografische Wandel wird ja auch nicht nur das Thema Kinder weiter mitbringen, sondern auch die Pflege von Angehörigen. Das heißt, was wir jetzt im Moment noch haben, dass die Frauen mit 40, 45 große Kinder haben und dann noch sagen können, ja, jetzt kann ich irgendwie wieder Vollzeit arbeiten. Das wird in Zukunft auch nicht mehr so sein, weil wir viel mehr pflegen werden, unsere Angehörigen. Und das wird auch ein Riesenthema werden.
[00:25:42] Ricarda Engelmeier: Ich habe in „MyCollective“ vor sechs Jahren angefangen, also kurz oder sechs, sieben Jahren kurz vor der Coronakrise und da war Diversity ein Thema, was irgendwo hinten links hinter dem Drucker geparkt war. Dann kam Corona und kurz danach ging es richtig los. Also es gab eine Diversity-Quote, die nicht mehr nur in der Aufsichtsratetage war, sondern dann auch auf die DAX-Vorstände. Das hat einen schönen Trickle-down-Effekt. Also auch Ebene zwei und drei müssen nachhaltig besetzt werden und mit Transparenz versehen. Das ist das Schöne. Das heißt selbst, nicht nur DAX-Unternehmen, die wirklich die Quote haben, sondern viele andere haben sich Ziele gesetzt. Und die Ziele sind jetzt immer transparenter. Und dann dachte man, Diversity wird immer stärker, es wird immer wichtiger, die Unternehmen nehmen das immer wichtiger. Jetzt habe ich so ein bisschen in diesem Jahr gemerkt, das Thema wird abgelöst von anderen brennenderen Themen und ist nicht mehr ganz so im Vordergrund. Was bedeutet das? Ist Fachkräftemangel jetzt kein Thema mehr? Ist Diversity kein Thema mehr?
[00:26:40] Patricia Cammarata: Also ich glaube, der Fachkräftemangel betrifft ja einfach verschiedene Branchen. Also es gibt sicherlich Branchen, die davon nicht so stark betroffen sind. Und Diversity ist ja auch immer eine Frage, wie wir das verargumentieren. Weil man kann das ja durchaus auch wirtschaftlich einfach durchrechnen, irgendwie, was es bringt. Also man macht das ja nicht aus Eigennutz, sondern weil man ja eben wirklich nachrechnen kann, dass da, wo Frauenquoten deutlich besser sind, auch die wirtschaftlichen Gewinne besser sind. Ich glaube, dass wir da vielleicht ein bisschen stärker in die Zahlen gucken müssen und da mal nachrechnen. Es geht ja nicht darum, Frauen einen Gefallen zu tun, sondern am Ende ist es immer ergebnisorientiert. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf gucken, das richtig zu verargumentieren. Und sicherlich gibt es aber auch Unternehmen, die das jetzt erst mal so gemacht haben und gar nicht so genau durchdacht haben, was das heißt. Also ich war heute bei einem Vortrag auch eben über das Führen in Teilzeit. Viele Unternehmen bieten das ja vielleicht an, aber die überlegen sich ja nicht, wenn wir das anbieten, was machen wir denn jetzt anders als bei einem, der jetzt sagt, ich arbeite 40 Stunden, sondern was da passiert, ist ja, dass man sagt, super, ich kriege hier 100 Prozent Leistung und zahle nur 80 Prozent. Und ich glaube, da gibt es natürlich schon Reibungspunkte, jetzt aus dieser Praxis heraus, irgendwie, dass man sieht, naja, also Moment mal, so war’s irgendwie nicht gedacht. Aber auch da bin ich zuversichtlich, also es ist ja immer eine Pendelbewegung, also von, wir haben da gar kein Interesse dran, Frauen oder Führung in Teilzeit oder auch Karrieremodelle für Frauen über 40, dann quasi irgendwas zusammenzudeichseln und dann zu sehen, ah ja, gut, dann müssen wir nochmal nacharbeiten. Aber ich glaube, die Nacharbeiten werden kommen, weil das hat mal einer in einer Frauenversammlung gesagt, so wie die Pandemie zwangsweise ein Treiber für die Digitalisierung war, so ist es der Fachkräftemangel tatsächlich auch für quasi Gleichberechtigung im Endeffekt. Zu was ich auch ermutigen möchte, ist: Es sind ja wirklich ganz oft auch die kleinen Sachen, die helfen. Also ich war in einem sehr männerdominierten Umfeld, ich arbeite ja hauptberuflich also 32 Stunden nochmal festangestellt. Und wir hatten eine männliche Führungskraft, der hatte auf seinem Lock-Screen einfach seine Kinder. Und er hat also jedes Mal, wenn er seinen Rechner angeschlossen hat, um irgendwie eine Präsentation zu machen, haben wir erstmal seine Kinder gesehen. Das war total toll, weil er damit wirklich auch präsent war mit, irgendwie, er hat dieses Thema und er will sich kümmern und er hat auch nicht irgendwie einen mysteriösen Terminblocker zweimal die Woche um 16 Uhr gehabt, sondern eben hat er geschrieben, hol meine Kinder vom Kindergarten ab, keine Termine, und das sind ja wirklich Sachen, die Dinge bewegen, die Vorbildcharakter haben, die den Frauen auch ganz viel erleichtern, aber die auch vielleicht Männern Mut machen, die diese Rolle auch wahrnehmen wollen. Also ich glaube, man muss so ein bisschen weg immer von diesem ganz Großen: Wir müssen alles auf einmal ändern! Wir müssen zu 50/50 kommen! So mehr diese Kleinen, also was kann ich irgendwie ab morgen machen, und dass sich dann so ein bisschen was in Gang setzt.
[00:30:04] Ricarda Engelmeier: Geht es dir denn da schnell genug? Geht das schnell genug oder brauchen wir doch noch mal einen Push aus der Politik oder so?
[00:30:11] Patricia Cammarata: Also ich bin sowieso ein sehr ungeduldiger Mensch, mir geht eh nichts schnell genug und die Sache geht mir auf jeden Fall nicht schnell genug. Im Gegenteil, es gibt ja immer wieder so Schlagzeilen, wenn ich sowas lese, mehr Lust auf Arbeit irgendwie und dass jetzt irgendwie alle Vollzeit arbeiten sollen, wo ich sage, ja schön, aber wer kümmert sich denn dann um die Kinder? Also wer kümmert sich um die Angehörigen, wer macht die ganzen Ehrenamtlichen, das Gemeindeengagement und so weiter? Wie kann das sein, dass Politiker sowas fordern, aber auf der anderen Seite eben nicht durchdenken, das geht ja irgendwo weg, weil der Tag hat einfach nur 24 Stunden und so funktioniert das ja nicht. Also das heißt, wir brauchen schon die richtigen Rahmenbedingungen auch, weil wir natürlich nur in diesen Rahmenbedinungen auch agieren können. Und das ist sehr schwierig und langwierig, aber auch da, denke ich, gibt es viele Hebel. Also ich würde mir wünschen, dass wir wegkommen von der 40-Stunden-Woche. Das ist ja undenkbar, aber das war in den 1960er Jahren auch undenkbar, dass wir von der 48-Stunde-Wochen auf die 40-Sunden-Woche kommen. Ich denke, das wäre definitiv der größte Hebel. Und auch so was, im Steuerrecht des Ehegattensplitting ist auch sehr schwierig, weil das ja nur ein bestimmtes Modell des Zusammenlebens begünstigt und eigentlich nicht mal Familie begünstigt, sondern Heiraten begünstigen. Und da gibt es sehr viel bessere Modelle quasi, um da Gerechtigkeit herzustellen, dass wir eben nicht in diese Diskussionen kommen, weil man Lohnsteuerklasse 5 hat, dass dann plötzlich auf das Nettogehalt geguckt wird, und dann muss man sich anhören, ja jetzt brauchen wir, weil wir auf dem Land leben, das zweite Auto, die Kinderbetreuung ist so teuer, du verdienst netto nur so und so, ja das lohnt sich ja gar nicht. Und deswegen glaube ich, ist auch so was, wenn es so ein trockenes Thema ist, so was wie das Steuerrecht schon sehr, sehr wichtig, um Gleichberechtigungen auch zu befördern.
[00:32:10] Ricarda Engelmeier: Da brauchen wir auch einen Musterbruch, würde ich sagen.
[00:32:13] Patricia Cammarata: Auf jeden Fall.
[00:32:15] Ricarda Engelmeier: Patricia, vielen Dank!