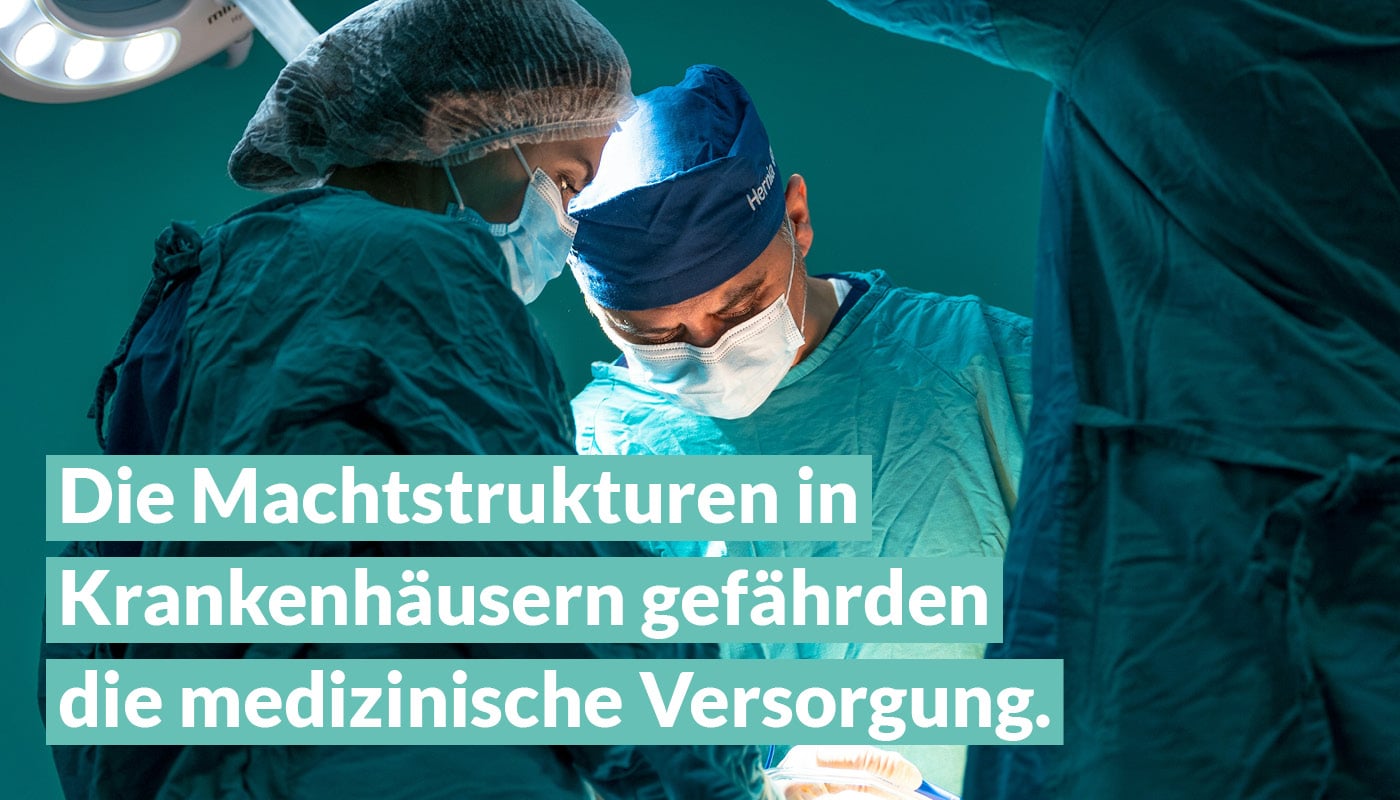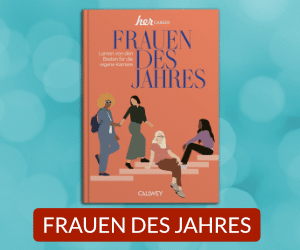Eine Caring Company legt den Fokus auf Fürsorge. Das bedeutet nicht, dass sie Care-Arbeit leistet oder in der Sozialwirtschaft tätig ist. Vielmehr hat eine Caring Company verstanden, dass ein patriarchales, kapitalistisches System Menschen und Planet nachhaltig erschöpft, und geht stattdessen fürsorgend mit ihrer Belegschaft und der Umwelt um. Wie das aussehen kann und warum die Zukunft der Arbeit in der Sorge füreinander liegt, schildern Dr. Esther Konieczny und Lena Stoßberger.
„Dem menschlichen Bedürfnis nach Fürsorge – in seiner gebenden und nehmenden Form – wird in dieser Leistungsgesellschaft überhaupt kein Wert beigemessen.“
herCAREER: „Die Leistungsgesellschaft schafft sich selber ab“, so lautet der Titel eures ersten Kapitels. Was meint ihr damit genau?
Dr. Esther Konieczny: Das kapitalistische Grundprinzip „schneller, höher, weiter” funktioniert nicht, weil der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, annimmt, dass unsere Ressourcen unendlich sind. Aber das sind sie eben nicht.
Lena Stoßberger: Ein Beispiel: In meiner Firma lag ein Flyer aus, auf dem stand: „Ein krankes Kind sollte zu Hause gepflegt werden.” Natürlich habe ich dem innerlich sofort zugestimmt, aber meinte damit, dass es von Mutter oder Vater gepflegt werden sollte. Der Flyer wollte natürlich, dass ich arbeiten gehe und mein krankes Kind extern betreut wird. Wir haben uns gefragt, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn Konkurrenzstreben ihr einziger Motor ist. Wir sind zum Schluss gekommen, dass dem menschlichen Bedürfnis nach Fürsorge – in seiner gebenden und nehmenden Form – in dieser Leistungsgesellschaft überhaupt kein Wert beigemessen wird. Und wenn, dann wird sie ökonomisiert. Und wird dem Anspruch echter Fürsorge nicht mehr gerecht.
herCAREER: Mit „Fürsorge” meint ihr allerdings weitaus mehr als die klassische Care-Arbeit …
Esther: Ja. Auch die ganz großen Krisen lassen sich im Kontext der Fürsorge betrachten: Die Klimakrise hat zum Beispiel etwas mit mangelnder Fürsorge für Umwelt und Mitmenschen zu tun. Die wachsende politische Spaltung lässt sich darauf zurückführen, dass wir einander nicht genug Fürsorge entgegenbringen.
herCAREER: Der Buchtitel spricht vom „guten Leben“. Warum stehen sich Erwerbsarbeit und ein gutes Leben momentan oft im Konflikt?
Esther: Es heißt immer, wie sollen mehr arbeiten. Dabei wird jedoch ignoriert, dass es uns statistisch betrachtet materiell so gut geht, wie lange nicht. Gleichzeitig haben wir extrem hohe Krankheitsstände. Man muss sich also fragen: Welche Verantwortung trägt die Wirtschaft eigentlich dafür, dass es Menschen und Umwelt gut geht? Und warum werden Unternehmen so selten als gesellschaftliche Akteure verstanden? In meinem Verständnis ist es Aufgabe unserer Wirtschaft, Wohlstand im Sinne von Wohlergehen zu erzeugen – stattdessen reduzieren wir Wohlstand auf eine Zahl in der Form des BIP. Das Bruttoinlandsprodukt bildet Warenströme ab, nicht aber, wie es den Menschen, der Umwelt geht – das kann man schon ein „kastriertes Verständnis“ nennen.
herCAREER: Wo habt ihr stattdessen nach Indikatoren für Wohlstand und Zufriedenheit gesucht?
Lena: Wir haben uns unter anderem viel mit der Postwachstumsökonomie beschäftigt. Einzig in der feministischen Ökonomie sind wir jedoch auf Gedanken zu Fürsorge gestoßen. Es hat uns überrascht, wie wenig diese Ideen rezipiert werden, denn die feministische Ökonomie liefert Antworten auf viele der Fragen, die sich die Wirtschaft seit Jahren stellt.
herCAREER: Was zum Beispiel?
Esther: Etwa, wenn wir Wohlstand im Sinne einer gesunden Gesellschaft – in all ihren Dimensionen – definieren, dann ist die Brücke dorthin die Fürsorge.
herCAREER: Und wie bauen wir diese Brücke?
Esther: Indem wir einen umfassenden Begriff von Fürsorge zugrunde legen: Fürsorge als Verantwortung füreinander. Dass wir Verantwortung übernehmen, dass es uns und unseren Mitmenschen gut geht, dass es dem Planeten gut geht, dass wir in einer guten, gesunden Gesellschaft leben. Fürsorge wird allerdings im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit meist auf Vereinbarkeit reduziert. Und das ist unserer Meinung nach nicht zukunftsfähig.
herCAREER: Warum nicht?
Lena: Weil Care-Arbeit so als etwas betrachtet wird, das wegorganisiert werden muss, damit Frauen mehr Zeit für Erwerbsarbeit haben. Wir stellen deshalb das Konzept der Vereinbarkeit an sich in Frage, weil es Dinge zusammenbringen will, die gar nicht zusammenpassen. Es ist doch paradox: Vereinbarkeit zwingt Mütter und Frauen, Care-Arbeit nach dem männlichen Anspruch auszulagern, und zwar an Pfleger:innen, Erzieher:innen, Assistent:innen, die ihrerseits oft ausgebeutet werden – mit dem Ziel, sich nicht mehr kümmern zu müssen. Das ergibt für uns keinen Sinn. Unsere Idee ist, dass Fürsorge als Prinzip aufgewertet werden muss.
herCAREER: Ihr sprecht von einer „Verwechslung, der die neoliberale Weltsicht“ zugrunde liegt. Sie verwechselt Wohlstand mit Leistung. Wie äußert sich das?
Esther: Erinnern wir uns: Wenn ein Staat ein hohes BIP hat, gehen wir davon aus, dass es den Menschen dort gut geht, was nicht zwingend sein muss. Bei Individuen machen wir das ähnlich: Wenn jemand eine Yacht, zwei Autos und zwei Villen hat, dann gehen wir davon aus, dass die Person viel geleistet hat, erfolgreich und glücklich ist. Vielleicht tun wir das, weil finanzieller Wohlstand messbar ist und somit greifbar. Lebensglück hingegen ist es nicht. Die Harvard Study of Adult Development, die mittlerweile fast 90 Jahre läuft, hat herausgefunden, dass nicht materielle Güter, sondern Beziehungen Menschen glücklich machen. Sollten wir also Wohlstand nicht vielmehr an guten Beziehungen messen und uns fragen, welche Rolle Fürsorge in diesem Zusammenhang spielt?
herCAREER: Für das Buch habt ihr mit einigen Caring Companys gesprochen. Wie schaffen sie es, Fürsorge zu leisten?
Lena: Vielleicht als Disclaimer vorweg: Natürlich sind die Firmen, mit denen wir gesprochen haben, keine Global Player und Konzerne, sondern kleine und mittelständische Unternehmen. Trotzdem glauben wir, dass man sich bei ihnen viel abschauen kann. Wir haben in diesen Firmen die Erkenntnis gewonnen, dass Fürsorge nicht aus einem Vision Statement entsteht, sondern aus zwischenmenschlichen Situationen und Mitgefühl für andere.
Esther: Wir haben aber explizit nach strukturellen Maßnahmen gesucht. Also zwischenmenschliche Impulse, die sich in Strukturen niederschlagen, etwa in Gehalt oder Arbeitszeitmodellen. Und das ist ein großer Unterschied zu einer New-Work-Bewegung, die – ich überspitze – oft versucht, strukturelle Probleme psychologisch zu lösen und dem Individuum aufzuerlegen, ein fehlerhaftes System zu kompensieren. Wir wollen das Gegenteil: Wir wollen erreichen, dass Fürsorge als Wert in Strukturen und Prozessen dargestellt und verankert wird.
herCAREER: Wie sieht eine fürsorgliche Gehaltsstruktur aus?
Esther: Das Unternehmen Einhorn Products ist uns mit einem fairen und transparenten Lohnsystem aufgefallen. Die Belegschaft hat sich gemeinsam (!) dafür entschieden, in ihrem Lohnsystem auch die Sorgeverantwortung der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Konkret bedeutet das: Mitarbeitende mit Sorgeverantwortung erhalten einen Gehaltsbonus von 400 Euro pro Kind. Hier wird nicht zwischen Vätern und Müttern unterschieden, was ich persönlich sehr gut finde, denn als Frau und Mutter macht man eher die Erfahrung, mit jedem Kind an Gehalt und Position zu verlieren.
herCAREER: Ein weiteres wichtiges Kriterium für ein gesundes Zusammenleben und ‑arbeiten ist Zeit. Welche Lösungen habt ihr da beobachtet?
Lena: Da muss ich vorausschicken, dass Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit unterschiedliche Zeitlogiken haben. Ich kann meine Erwerbsarbeit zwischen 9 und 17 Uhr erledigen, meine Fürsorgearbeit kann ich dagegen nicht so terminieren. Ich kann mein Kind nicht „schneller erziehen“. Diese Diskrepanz führt dazu, dass Zeithoheit zu einem zentralen Attribut in Caring Companys wird. Natürlich muss sie sich den unternehmerischen Anforderungen anpassen. Genauso klar ist, dass einige gemäß ihrer Aufgabengebiete, etwa im Kundenkontakt, weniger Zeithoheit haben als andere. Aber der Stress, den diese verschiedenen Zeitlogiken verursachen, muss von Arbeitgeber:innen anerkannt werden.
herCAREER: Und wie können sie dann konstruktiv darauf eingehen?
Lena: Ein erster Schritt kann hier sein, das Thema anzusprechen und die Bedürfnisse im Team abzufragen, damit alle sagen können: Was ist für mich entlastend?
Esther: Hier haben wir unterschiedliche Beispiele erlebt. Eine Digitalagentur wie Rheingans GmbH, die ja für ihre 5-Stunden Tage bekannt sind, hat natürlich mehr Gestaltungsraum als das Elektroinstallationsunternehmen, mit dem wir gesprochen haben. Allerdings ist ein Elektriker konsequent im Feierabend, während kreative Beschäftigte vielleicht auch abends und am Wochenende mit ihren Ideen befasst sind – es herrscht eine Entgrenzung von Arbeits- und Freizeit. Lasse Rheingans hat mit seinem Team die Prozesse so optimiert, dass dieselben Aufgaben in weniger Zeit verrichtet werden können. Das kann ein Elektroinstallationsunternehmen natürlich nicht. Die Firma hat entschieden, dass die Zeiterfassung für die Installateur:innen bereits in dem Moment beginnt, in dem sie auf den Hof fahren. Das ist eher ungewöhnlich, denn in der Regel wird die Arbeitszeit erst ab Ankunft auf der Baustelle erfasst. Das entspricht einer Reduktion von etwa drei Wochenstunden und macht für die Belegschaft einer Firma, die fast ausschließlich analog arbeitet, einen großen Unterschied.
herCAREER: Ist es auch fürsorgend, wenn sich ein Unternehmen politisch positioniert? Wenn Rossmann etwa als offene Kritik an Elon Musks Politik beschließt, keine Teslas mehr in die Flotte aufzunehmen?
Lena: Das hatten wir bei unserer Recherche nicht im Fokus. Dennoch haben wir bei allen Unternehmen, die wir vorstellen, eine Haltung wahrgenommen, die sich darin gezeigt hat, wie sie mit ihren Mitarbeitenden und der Umwelt umgehen. Implizit war die gesamte Kultur von dieser Haltung getragen, sodass ich vermute, dass es auch bei Rossmann eine Tendenz zu Fürsorge gibt.
Esther: Ich möchte das ergänzen: Es ist erst mal gut, wenn Unternehmen sich politisch positionieren. Dennoch ist langfristiges Denken sehr viel mühsamer, als einmal die Pressemeldung rauszuhauen, die besagt: „Ab jetzt keine Teslas mehr bei uns.“ Wir erleben derzeit eine politische Radikalisierung an den Enden und können wahnsinnig viel Unzufriedenheit beobachten. Wir erleben, dass viele Menschen sich abgehängt, sich nicht mehr verstanden und gehört fühlen und dann vielleicht ihr Kreuzchen bei der A*D machen. Das „Nicht-hinhören“ ist aber nicht nur ein politisches Problem, sondern auch eine Kultur, die wir in Unternehmen und der Wirtschaft als Ganzes geschaffen haben. Wir glauben immer noch: Wer fleißig ist, der wird belohnt, ist also erfolgreich. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass diejenigen, die nicht erfolgreich sind, wohl faul sein müssen. Ist das so? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir die individuellen Bedingungen und Voraussetzungen für „Erfolgreich-sein“ nicht einbeziehen?
herCAREER: Was genau macht also ein Unternehmen zu einer Caring Company?
Esther: Eine feste Checkliste oder klare Operationalisierung gibt es nicht. Wir haben keine Formel gefunden, die Caring Companys eindeutig definiert. Aber keines der von uns untersuchten Unternehmen hat sich vorher als Caring Company bezeichnet. Sie haben durch uns erst erkannt, dass sie fürsorgend handeln mit ihrer Selbstorganisation, mit New-Work-Elementen und Aspekten der Gemeinwohlökonomie.
Lena: Wichtig war uns, den Begriff klar von einem patriarchalen Verständnis abzugrenzen. Eine Caring Company kümmert sich nicht einfach „von oben nach unten“ um Belegschaft und Umwelt. Sie versteht Fürsorge vielmehr als ein gegenseitiges Sehen und Hören aller Beteiligten – keine Hierarchie, sondern ein respektvolles, konstruktives Miteinander.
herCAREER: Was bleibt denjenigen, die nicht in einem Vorzeigeunternehmen arbeiten?
Lena: Die meisten Leser:innen sind wahrscheinlich nicht in der Position, Unternehmensstrukturen grundlegend zu verändern. Ein guter Anfang ist jedoch das Bewusstsein der eigenen Selbstwirksamkeit: zu erkennen, dass sich Erwerbszeit und Care-Arbeit oft nicht vereinbaren lassen und ein Obstkorb keine echte Fürsorge ersetzt. Dieses Verständnis schafft Raum für Gespräche mit Kolleg:innen und Führungskräften über echte und dringende Bedürfnisse.
Esther: Unser Buch will keine Lösungen liefern, sondern vielmehr inspirieren. Erst wenn wir das akute Problem umfassend verstanden haben, können wir mit Lösungsansätzen beginnen. Wir wollen Mut machen, grundlegende Fragen zu stellen: In welcher Wirtschaft und Arbeitswelt wollen wir leben? Wie sieht echter Wohlstand für uns aus? Wie gelingt mehr Sein, weniger Haben? So wollen wir Orientierung geben.
Das Gespräch führte herCAREER Redakteurin Kristina Appel.
Über die Personen
Dr. Esther Konieczny
Wie wollen wir arbeiten, leben und füreinander sorgen? Diese Frage steht im Zentrum von Esthers Tätigkeiten als Beraterin, Coach, Aktivistin und Autorin. In unterschiedlichen Rollen engagiert sie sich für eine gesunde, gerechte und fürsorgeorientierte Gesellschaft und Arbeitswelt.
Seit über zehn Jahren begleitet sie Unternehmen und Non-Profit-Organisationen in Innovations- und Transformationsprozessen. Mit einem breiten methodischen Repertoire stärkt sie Selbstorganisationskompetenz, unterstützt neue Formen der Zusammenarbeit und fördert ein gelebtes Verständnis von New Work.
Auch ehrenamtlich setzt sie sich für eine fürsorgende Gesellschaft ein: Esther ist Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Fair für Kinder e.V.. Der Verein kämpft für die steuerliche und finanzielle Entlastung von Alleinerziehenden, die Anerkennung von Alleinerziehenden als gleichwertige Familien und mehr Care-Gerechtigkeit.
Ihre Vision einer care-sensiblen Gesellschaft hat sie gemeinsam mit Lena Stoßberger im Buch Arbeit und das gute Leben. Wie wir Wohlstand neu erfinden entwickelt. In all ihren Tätigkeiten verbindet sie Fachwissen mit dem Willen zur Veränderung – und schafft Räume, in denen Wandel möglich wird.
Lena Stoßberger
Lena Stoßberger ist studierte Betriebswirtin und arbeitet als Organisationsentwicklerin und Change Managerin mit Unternehmen und mit Menschen, die die Zukunft der Arbeit aktiv neu denken und gestalten. Ihre Schwerpunkte sind dabei: Führungsmodelle, Selbstorganisation, neue Formen der Zusammenarbeit und mentale Gesundheit.
Als ausgebildete Psychotherapeutin, systemische Beraterin und Prozessbegleiterin unterstützt sie Menschen dabei, das eigene Erleben von Selbstwirksamkeit zu entwickeln und zu stärken, um sich an der Gestaltung ihrer Arbeitsrealitäten aktiv zu beteiligen. „Wenn wir uns trauen, außerhalb eines Systems von Entfremdungs- und Trennungslogiken zu denken, können wir gemeinsam eine Arbeitsrealität miteinander aushandeln, in der wir angstfrei unser ganzes Menschsein leben können.“
Selbstwirksame und sich selbst steuernde Menschen sind das größte Asset von Unternehmen, die in Zukunft erfolgreich sind.
Am Freitag, den 10. Oktober 2025 sprechen die Autorinnen Dr. Esther Konieczny und Lena Stoßberger beim Authors-MeetUp auf der herCAREER Expo mit Moderatorin Silvia Feist über eine neue Definition von Wohlstand und über Wege, das Prinzip Fürsorge zum Maßstab unternehmerischen Handelns zu machen.